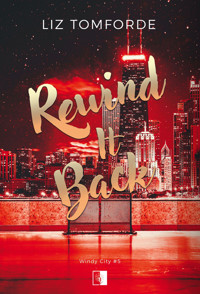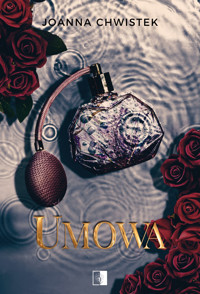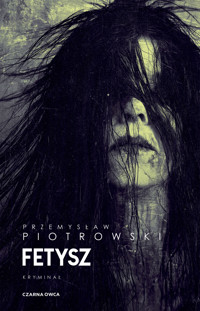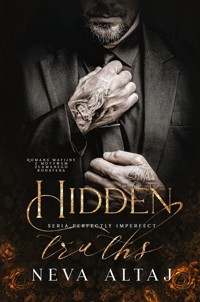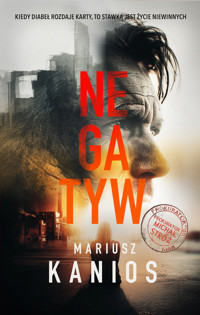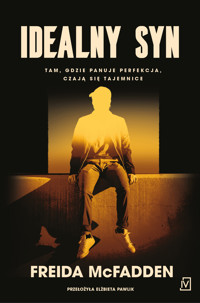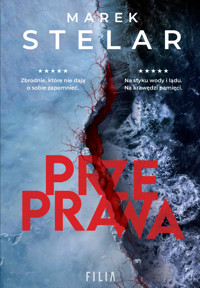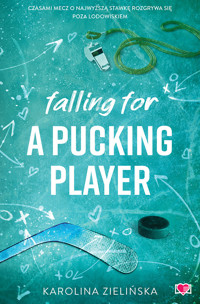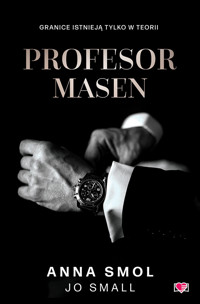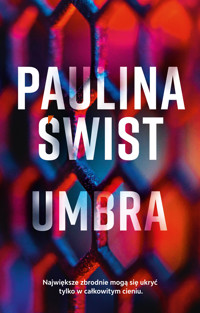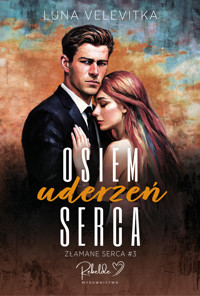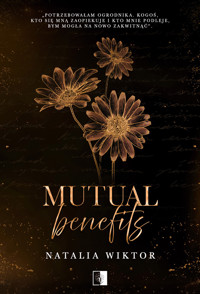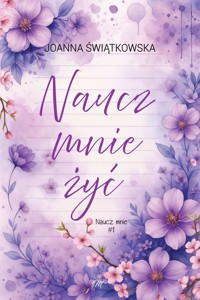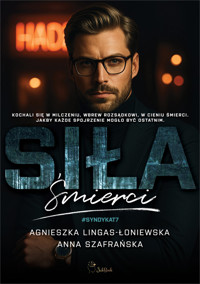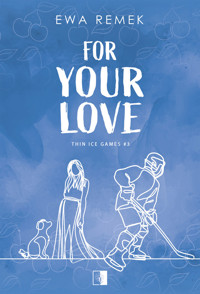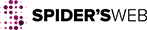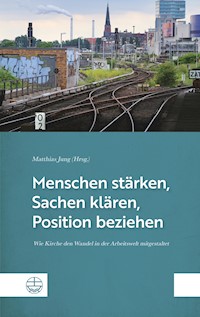
Menschen stärken, Sachen klären, Position beziehen ebook
Uzyskaj dostęp do tej i ponad 250000 książek od 14,99 zł miesięcznie
- Wydawca: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategoria: Religia i duchowość•Religie
- Język: niemiecki
Der Wirtschaftsjournalist Markus Götte führte im Auftrag des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) Interviews mit aktiven und früheren Mitarbeitenden durch. Die Gespräche geben einen Einblick in die vielfältige Arbeit des KDA: Brücken bauen, Horizonte erweitern, Verständigung ermöglichen, Konflikte moderieren, Beratungsarbeit, Netzwerkpflege – das sind nur einige der Stichworte, die hier aufgegriffen und mit Leben gefüllt werden. Die Interviews geben zugleich Einblicke in die Veränderungen, in denen sich die Arbeitswelt befindet, und informieren über den Versuch, diesen Wandel als Kirche zu begleiten und mitzugestalten. [Empowering People, Sorting Things Out, Taking Position. How Church Helps Shape the Change of the Working World] On behalf of the Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (working group for pastoral service in the working world of the Evanglical Church in Germany) business journalist Markus Götte conducted interviews with active and former employees. The interviews provide an insight into the many tasks of the KDA: building bridges, broadening horizons, facilitating communication, moderating conflicts, advisory work, networking – these are just a few of the key words that are taken up and filled with life in this book. At the same time, the interviews provide an insight into the changes the world of work is experiencing and the attempt to accompany and help shape these changes as a church.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 221
Rok wydania: 2020
Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na: