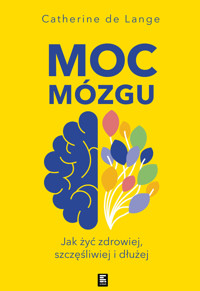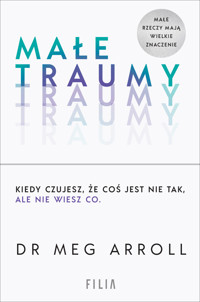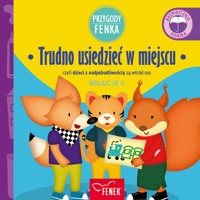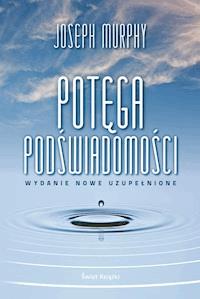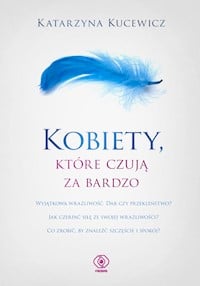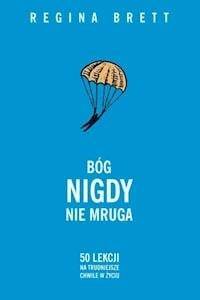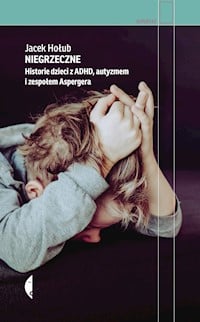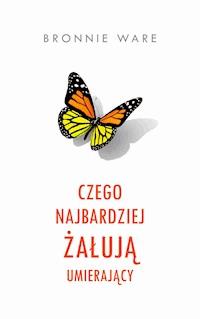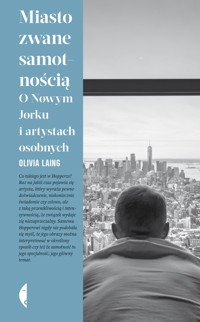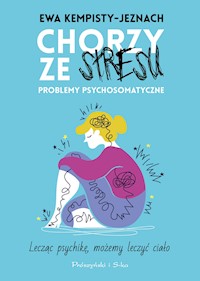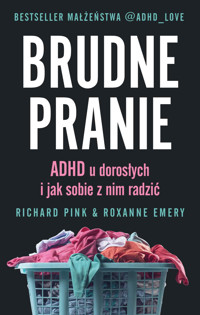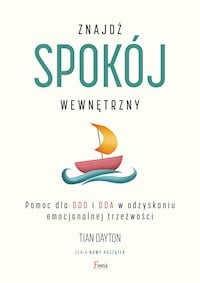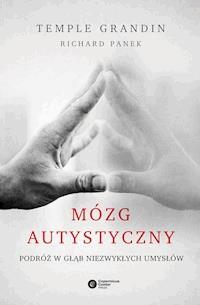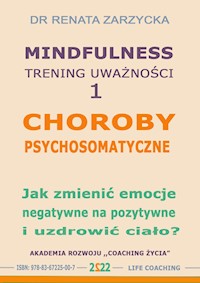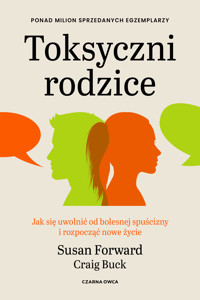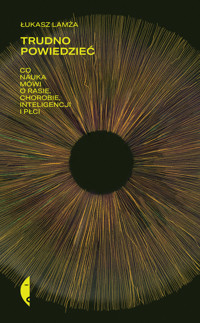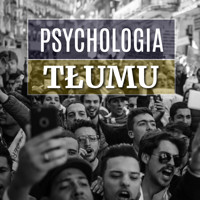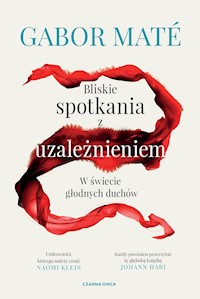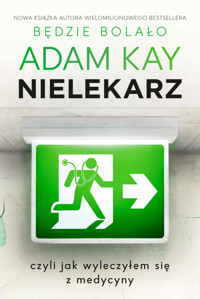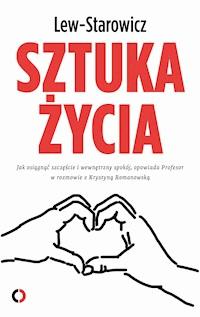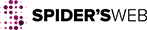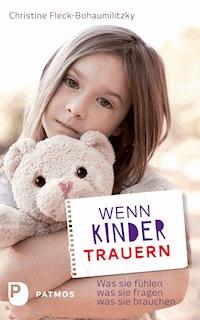
Uzyskaj dostęp do tej i ponad 250000 książek od 14,99 zł miesięcznie
- Wydawca: Patmos Verlag
- Kategoria: Poradniki•Zdrowie
- Język: niemiecki
Kinder trauern nicht nur beim Tod eines Menschen oder ihres Haustieres, sondern ebenso beim Verlust eines Kuscheltieres oder beim Wegzug eines Freundes. Wie Eltern und Erziehende in Kita, Kindergarten und Grundschule Kindern helfen können, mit solchen Verlusten umzugehen, beschreibt die Autorin einfühlsam, kompetent und hilfreich.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 96
Rok wydania: 2016
Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:
0,0
Oceny przyznawane są przez użytkowników Legimi, systemów bibliotecznych i innych serwisów partnerskich. Przyznawanie ocen premiowane jest punktami Klubu Mola Książkowego.
Legimi nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub czytali/słuchali daną pozycję, ale usuwa fałszywe opinie, jeśli je wykryje.