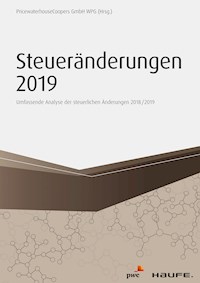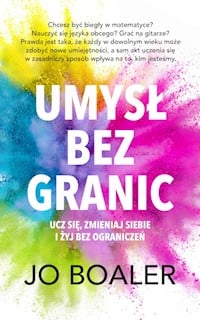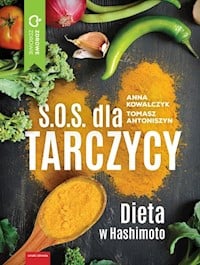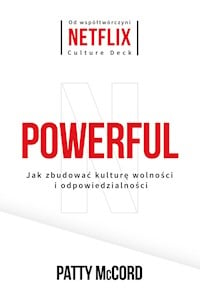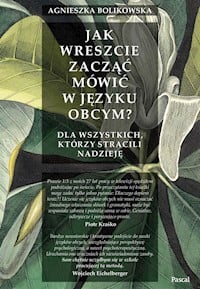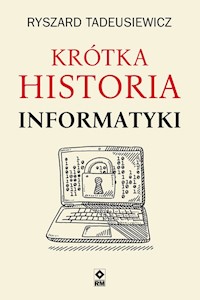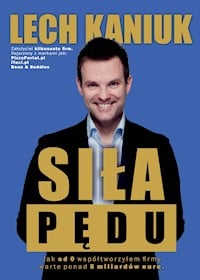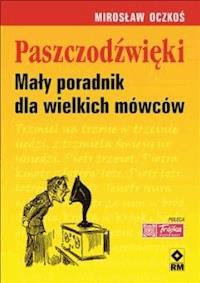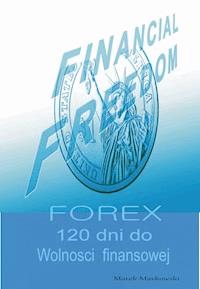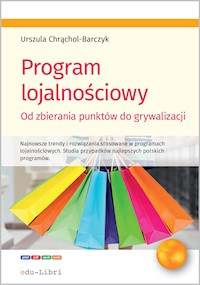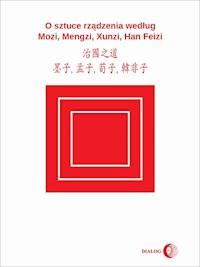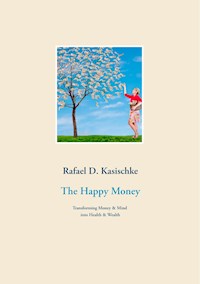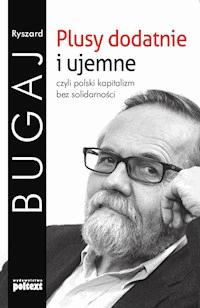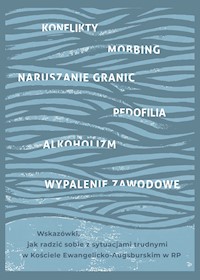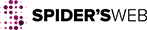409,99 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: Haufe
- Kategoria: Biznes, rozwój, prawo
- Język: niemiecki
Steuerliche Änderungen zu verpassen, ist riskant. Dieses jährlich erscheinende Arbeitsbuch vermittelt Ihnen einen detaillierten Überblick und nimmt Ihnen die mühsame Auswertungsarbeit ab. Damit haben Sie die Sicherheit, keine relevante Steueränderung zu übersehen. Vertrauen Sie auf das Autorenteam der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG. Die erfahrenen Berater und Wirtschaftsprüfer stehen für rechtliche Aktualität und höchste Kompetenz im Steuerrecht. Inhalte: - Analyse der steuerlichen Änderungen 2017/2018 - Überblick über die Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen 2017 - Aktuelle SteuerreformpläneDas Steuerjahrbuch von PwC ist ein etabliertes Nachschlagewerk in zahlreichen Steuerbüros und Kanzleien.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 909
Rok wydania: 2018