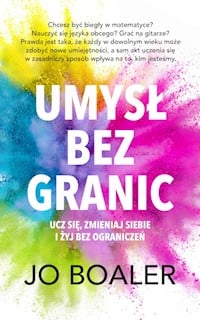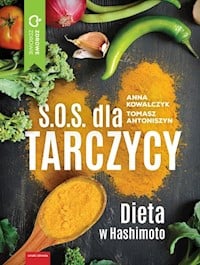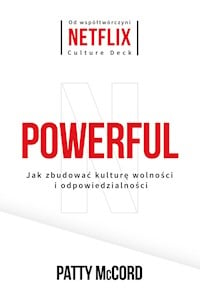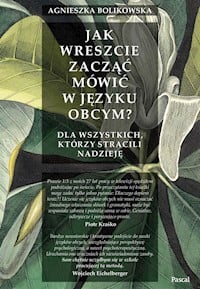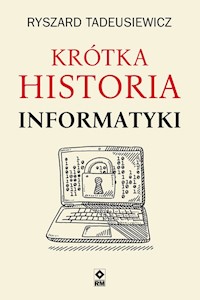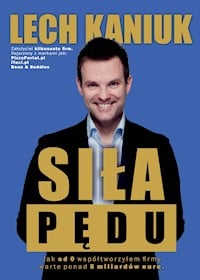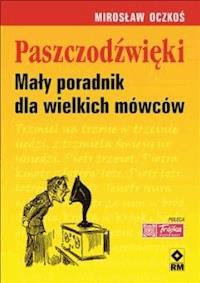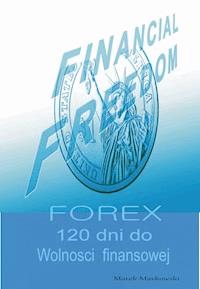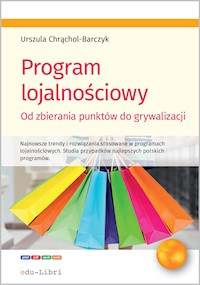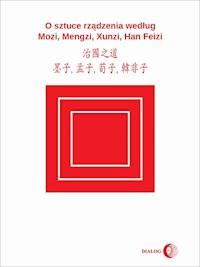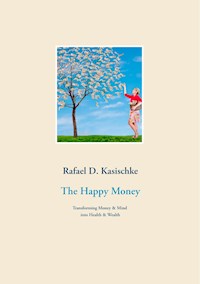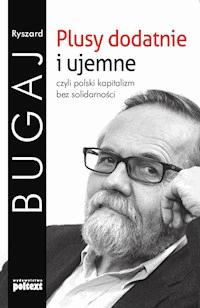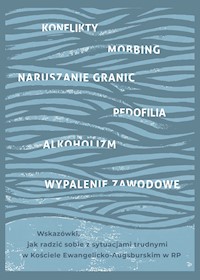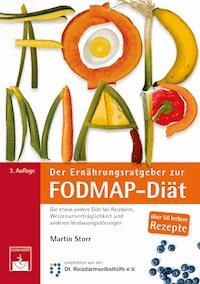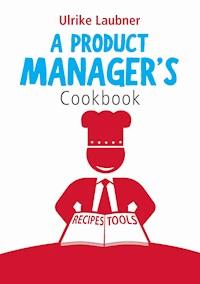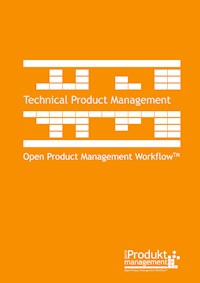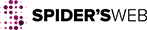102,99 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: Haufe
- Kategoria: Biznes, rozwój, prawo
- Język: niemiecki
Unklare Vorgaben, enge Zeitpläne und knappe Budgets bestimmen den Alltag des Projektmanagements. Dieses Checkbook hilft Ihnen als Projektmanager in jeder Situation, Ihr Projekt mit Erfolg zu steuern. Zahlreiche Checklisten für jeden einzelnen Projektschritt und viele Praxistipps geben Ihnen wertvolle Hilfen, die Sie sofort bei der täglichen Arbeit einsetzen können. Inhalte: - Praxistipps für weniger Stress: So handeln Sie am effektivsten - Projektvorbereitung und Projektplanung: die Grundlage für den Erfolg schaffen - Pro-aktive Projektsteuerung für reibungslose Abläufe - Setzen Sie Standards: Projektcontrolling und Qualitätsmanagement - Den Erfolg sichern: gelungene Übergabe, Einführung und AbnahmeArbeitshilfen online: - Alle Checklisten - Formulare und Vorlagen - Excel-Arbeitshilfen
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 202
Rok wydania: 2017