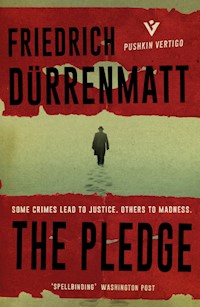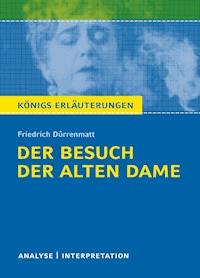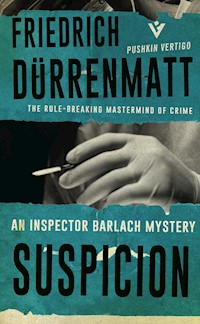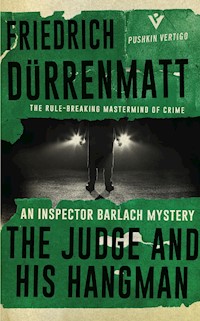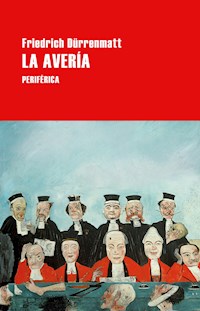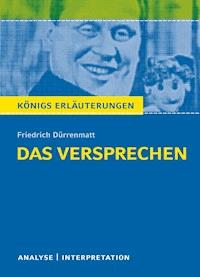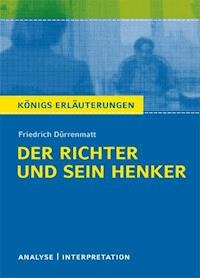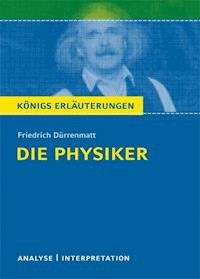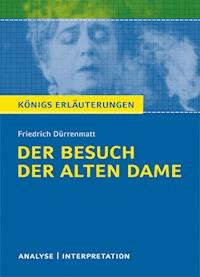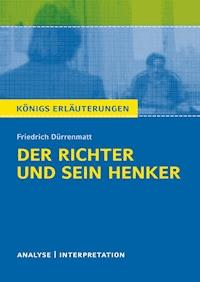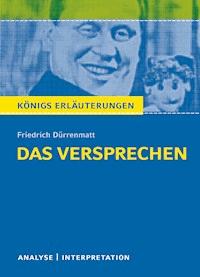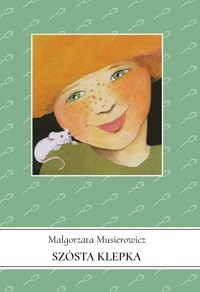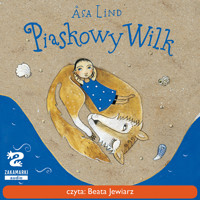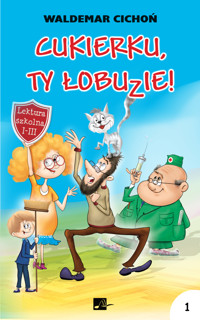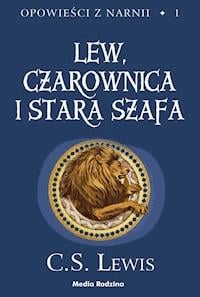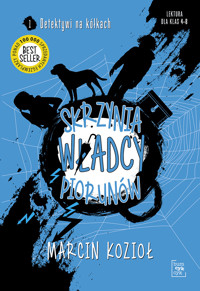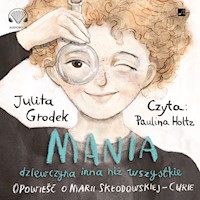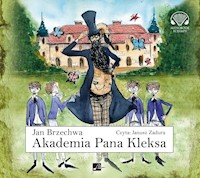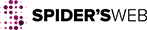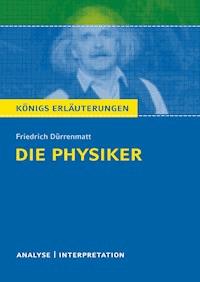
37,99 zł
Dowiedz się więcej.
Königs Erläuterungen zu Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker - Textanalyse und Interpretation mit ausführlicher Inhaltsangabe und Abituraufgaben In einem Band bieten dir die neuen Königs Erläuterungen alles, was du zur Vorbereitung auf Referat, Klausur, Abitur oder Matura benötigst. Das spart Zeit bei der Vorbereitung! Alle wichtigen Infos zur Interpretation. - von der ausführlichen Inhaltsangabe über Aufbau, Personenkonstellation, Stil und Sprache bis zu Interpretationsansätzen - plus 4 Abituraufgaben mit Musterlösungen und 2 weitere zum kostenlosen Download . sowohl kurz als auch ausführlich. - Die Schnellübersicht fasst alle wesentlichen Infos zu Werk und Autor und Analyse zusammen. - Die Kapitelzusammenfassungen zeigen dir das Wichtigste eines Kapitels im Überblick - ideal auch zum Wiederholen. - Das Stichwortregister ermöglicht dir schnelles Finden wichtiger Textstellen. . und klar strukturiert. - Ein zweifarbiges Layout hilft dir Wesentliches einfacher und schneller zu erfassen. - Die Randspalte mit Schlüsselbegriffen ermöglichen dir eine bessere Orientierung. - Klar strukturierte Schaubilder verdeutlichen dir wichtige Sachverhalte auf einen Blick. . mit vielen zusätzlichen Infos zum kostenlosen Download.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 142
Rok wydania: 2015