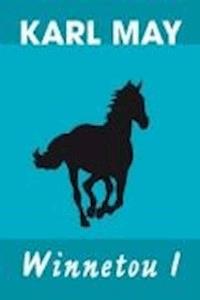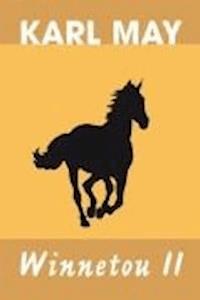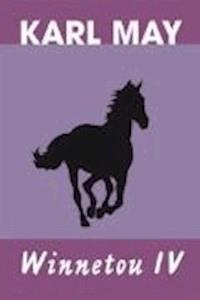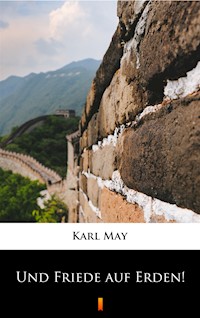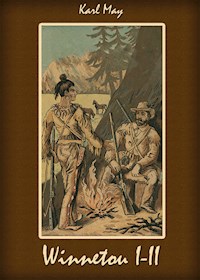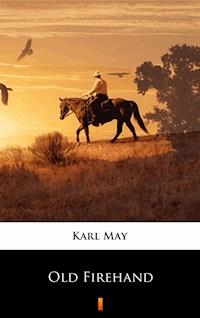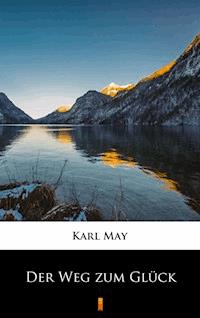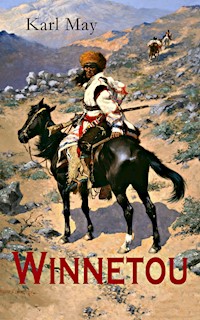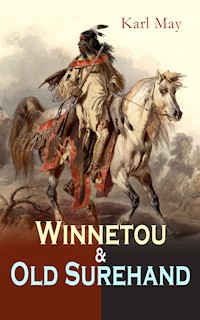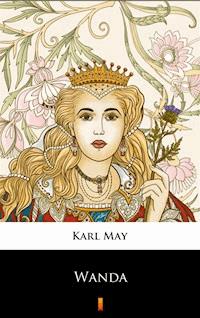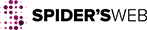Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
DO 50% TANIEJ: JUŻ OD 7,59 ZŁ!
Aktywuj abonament i zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego, aby zamówić dowolny tytuł z Katalogu Klubowego nawet za pół ceny.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: KtoCzyta.pl
- Kategoria: Powieści przygodowe i historyczne
- Język: niemiecki
Die Liebe des Ulanen: Original-Roman aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges ist ein Werk von Karl May. Kurz vor der Schlacht von Waterloo verliebt sich der preußische Offizier Hugo von Königsau in die Französin Margot Richemonte. Deren Stiefbruder Albin versucht die Verbindung zu verhindern und Königsau zu töten. Dies gelingt ihm nicht, doch Jahre später kann er die Familie ruinieren und Königsaus Sohn Gebhardt verschleppen. Der Ulanenrittmeister Richard von Königsau reist im Jahre 1870 inkognito und als buckliger Erzieher verkleidet nach Ortry in Lothringen, um im Schlosse des Gardekapitäns Albin Richemonte tragische Familiengeheimnisse aufzuklären und französischen Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland auf die Spur zu kommen. Auf dem Weg nach Ortry rettet er Marion, Richemontes schöner Enkelin, das Leben und entdeckt seine Liebe zu ihr.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 1970
Podobne
Karl May
Die Liebe des Ulanen
Warschau 2018
Inhalt
1. Kapitel. Zwei Gegner
2. Kapitel. Ein Veteran
3. Kapitel. Ein Zauberer
4. Kapitel. Eine Kriegskasse
5. Kapitel. Die letzte Liebe Napoleons
6. Kapitel. Die Tochter des Kabylen
7. Kapitel. Verarmt
8. Kapitel. Ein Kundschafter
9. Kapitel. Zum Kriege drängend
1. Zwei Gegner.
Der Moseldampfer, welcher des Morgens halb sieben Uhr von Coblenz abfährt, um nach einem Uebernachten in Traben-Trarbach die Passagiere nach Trier zu bringen, hatte Zell verlassen, und arbeitete sich von Neuem auf den Wellen des herrlichen Stromes aufwärts.
Nebst anderen Passagieren, welche meist den zweiten Platz besetzten, war eine Gesellschaft junger Herren aufgestiegen, welche sich in jener selbstbewußten, nonchalanten Weise nach dem ersten Platz begaben, die den Angehörigen einer bevorzugten Lebensstellung eigen zu sein pflegt. Sie musterten die Mitfahrenden mit kalten, von oben herabfallenden Blicken und nahmen unter dem gegen die Sonnenstrahlen aufgespannten Schutzdache Platz, ohne sich darum zu bekümmern, ob sie Anderen die wohl berechtigte Aussicht auf die lachenden Ufer raubten, oder sonst in einer Weise lästig wurden. Ihr in französischer Sprache geführtes Gespräch war so lärmend, so rücksichtslos laut, daß sich Aller Blicke verweisend auf sie richteten, doch nahmen sie nicht die geringste Rücksicht davon. Bei Leuten, welche der gewöhnlichen Volksklasse angehören, hätte man dieses Verhalten ungezogen genannt, hier jedoch schwieg man, indem man es vorzog, die Rücksichtslosigkeit nur im Stillen zu kritisiren.
Einer von ihnen, welcher ein riesiges Monocle in das Auge gepreßt hatte, deutete mit seinem Stöckchen auf das Ufer und sagte so laut, daß es Jedermann hören konnte:
»Lieber Graf, ist es nicht eine Schande, daß ein so schöner Fluß und ein so reizendes Land unserem Frankreich noch immer vorenthalten wird? Wann endlich werden wir einmal marschiren, um uns die linke Seite des Rheines, welche uns gehört, zu holen. Ich hasse die Deutschen!«
»Und bereisest doch ihre Länder, bester Oberst!« meinte spöttisch Derjenige, an welchen die Worte gerichtet gewesen waren.
»Pah!« antwortete der Oberst. »Man weiß ja, weshalb man sie bereist. Muß man nicht einen Gegenstand, den man erlangen will, vorher prüfen und kennen lernen?«
Er sprach das in einem Tone, als ob man hinter seinen Worten irgend ein wichtiges Geheimniß zu suchen habe. Er war ein wirklich schöner Mann, und da er bei seiner Jugend bereits den Rang eines Obersten bekleidete, so war anzunehmen, daß er von außergewöhnlicher Geburt sei und einflußreiche Connexionen besitze.
»Donnerwetter, still!« sagte sein Nachbar halblaut. »Du geräthst sonst in Gefahr, von diesen guten Teutonen für einen geheimen Emissär gehalten zu werden!«
»Mögen sie es thun! Diese Herren Spießbürger sind sehr ungefährlich. Ein Kampf mit ihren tapferen Heerschaaren müßte ein wahres Vergnügen sein. Ich bin überzeugt, daß wir im Falle eines Krieges mit ihnen einen sehr unterhaltenden Spaziergang nach Berlin machen würden.«
»Darüber giebt es gar keinen Zweifel, nämlich, was den Spaziergang betrifft; ob er aber wirklich viel Unterhaltung bringen würde, das ist sehr fraglich. Diese Deutschen sind ein höchst langweiliges Volk, roh, grob, zugehackt. Blicke Dich um! Findest Du unter den Passagierinnen ein einziges Gesicht, welches der Mühe werth wäre, geküßt zu werden? Ich werde einmal nach der Kajüte gehen, um zu sehen, ob es dort vielleicht etwas Besseres giebt.«
Er erhob sich und stieg die enge Treppe hinab, welche nach dem angegebenen Orte führte. Wer die beiden Damen sah, welche da unten auf der schwellenden Plüschottomane saßen, der mußte sich sagen, daß der Graf hier finden werde, was er suchte.
Es war eine Blondine und eine Brünette. Die Erstere war von mittlerer Größe und sehr feinen, doch jugendlich vollen Formen. Unter langen, weichen Wimpern glänzte das milde Licht zweier himmelblauer Augen, durch welche man tief auf den Grund einer sanften, hingebenden Seele blicken zu können schien. Dieses Mädchen war zwar keine imposante, hinreißende Schönheit, aber in ihrer Anmuth und Lieblichkeit mußte sie selbst in einem auserwählten Damenkreise als hervorragend bezeichnet werden.
Ganz anders die Brünette. Von hoher, junonisch voller Gestalt, schien sie nur zum Gebieten bestimmt zu sein. Ihre Züge glichen denjenigen, welche der Maler jenen persischen Schönheiten zu geben pflegt, welche geschaffen sind, die Sterne eines ganzen Harems zu verdunkeln. Der herrlich modellirte Kopf trug eine Fülle kastanienbrauner Haare, welche die Zofe jedenfalls nur schwer überwältigen konnte. Auf der alabasterweißen Stirn thronte ein Adel, welcher dem Gesichte den Charakter der Unnahbarkeit verlieh. Die großen, unter herrlich geschwungenen Brauen blitzenden, und von vollen, seidenen Wimpern beschatteten Augen, besaßen jene mandelähnliche Form, welche nur der Orient zu geben vermag; doch war diese Form nicht in jener determinirten Weise ausgeprägt, welche man an den unvermischt gebliebenen Kindern Israels bemerkt. Das kleine, nur leicht und außerordentlich graziös gebogene Näschen war zwar sehr fein geschnitten, zeigte aber doch zwei rosig angehauchte Flügel, welche sich ganz energisch aufzublähen vermochten. Der kleine Mund war geradezu wunderbar gezeichnet zu nennen. Ganz wie zum glühenden, überwältigenden Kusse gemacht, zeigten die granatnen Lippen doch nicht jene auffallende Fülle, welche nur das Vorrecht besonders sinnlicher Naturen zu sein scheint. Und wenn sich diese Lippen zu einem Lächeln öffneten, so erschienen zwei Reihen perlenkleiner Zähnchen, an denen sicher selbst der erfahrenste Dentist kein Fehlerchen hätte entdecken können. Dieser Mund stand eigentlich im Widerspruch mit sich selbst, doch gerade dieser Contrast war es, der ihn bezaubernd machte. Um die eigenartig graziöse Schwingung der Lippen lagerte sich Trotz und Sanftmuth, Stolz und Milde, Selbstbewußtsein und Hingebung, Kühnheit und weibliches Zagen, und es mußte der Zukunft überlassen bleiben, welche von diesen Eigenschaften die Oberhand erlangen, und dem Gesichte dann sein vollendetes Gepräge ertheilen würde.
Die Gestalt dieser Dame war voll, aber nicht unschön, üppig, obgleich ein pedantischer Kritikus vielleicht gesagt hätte, daß der Busen, welcher seine sommerlich leichte Hülle zu zersprengen drohte, die Blicke der Männer ein ganz klein Wenig zu sehr auf sich zu ziehen vermöge. Das feingewebte, eng anschließende Reisekleid war nicht vermögend, die herrlichen Formen eines sinnberückenden Körperbaues ganz zu verbergen. Das kleine, aber kräftig gebaute Händchen schien nur bestimmt zu sein, mit Inbrunst an das Herz gedrückt zu werden, und unter dem leise emporgerafften Saume des Kleides blickte ein Füßchen hervor, welches den Neid von tausend Damen zu erwecken vermochte.
Diese beiden Mädchen waren in ein sehr erregtes Gespräch vertieft. Sie führten dasselbe, obgleich sie sich ganz allein befanden, doch mit unterdrückter Stimme. Es war daraus zu errathen, daß sie sich vielleicht sehr wichtige und doch sehr jungfräuliche Geheimnisse mitzutheilen hatten.
»Aber, liebe Marion,« sagte die Blonde, »davon habe ich bisher ja gar nichts gewußt! Ich denke, wir haben niemals ein Geheimniß gehabt, und nun erfahre ich zu meinem Erstaunen, daß Du gerade das Allerwichtigste, was es für ein Mädchen giebt, mir so lange Zeit und so hartnäckig verschwiegen hast!«
Die Brauen der Brünetten zogen sich leicht zusammen, und sie antwortete:
»Ich habe mich keiner Verschwiegenheit gegen Dich schuldig gemacht, meine gute Nanon. Ich habe dieses Geheimniß ja erst aus dem letzten Briefe erfahren, welchen Papa mir schrieb. Hier, hast Du ihn!«
Ihre Stimme klang kräftig, voll und rein wie Glockenton. Man hörte es ihr an, daß sie vom gebieterischesten Befehle an bis herab zum süßesten Liebesgeflüster aller Modulationen fähig sei. Es war das eine Stimme von seltener Resonanz und dabei doch so biegsam und weich; sie besaß die Kraft des Herrschens und die Innigkeit des Einschmeichelns; sie klang so sonor und doch so warm; ihr Ton schien nicht zwischen den Ligamenten des Kehlkopfes, sondern in der Tiefe der Brust gebildet zu werden, oder aus der untersten Kammer des Herzens, dem heiligsten Innern der Seele, zu kommen. Wer die Stimme hörte, wurde gebannt und ergriffen wie Einer, der im Dunkel eines hohen Domes kniet und plötzlich aus der Höhe des Orgelchores den wunderbaren, zauberischen Klang der Voxhumana erzittern hört.
Marion griff in ein zierliches Saffiantäschchen, welches an ihrem Gürtel hing und dessen massiv goldener Bügel mit echten Ceylonperlen besetzt war, und zog einen Brief hervor, welchen sie der Freundin reichte. Diese öffnete ihn, um ihn zu lesen. Während sie dies that, nahmen ihre lieblichen Züge den Ausdruck des höchsten Erstaunens an, und als sie das Blatt wieder zusammengefaltet hatte und es zurückgab, sagte sie unter einem bedenklichen Schütteln des feinen Köpfchens:
»Das ist wirklich ganz außerordentlich! Du sollst schleunigst nach Hause zurückkehren, um den Dir bestimmten Bräutigam kennen zu lernen! So hast Du diesen Oberst, Graf Rallion, noch niemals gesehen?«
»Nie. Ich weiß nur, daß die Rallions von sehr altem, aber verarmtem Adel sind und daß der jetzige Chef der Familie die Gunst der Kaiserin, also auch des Kaisers, in hohem Grade besitzt. Dies ist jedenfalls auch der Grund, daß sein Sohn bereits Oberst ist, obgleich er ein noch jugendliches Alter zu besitzen scheint.«
»Aber wie kommt Dein Papa zu dem Projecte dieser rein geschäftsmäßigen Verbindung?«
»Das ist auch mir ganz unbegreiflich. Ich werde es aber baldigst erfahren.«
Diese Worte waren in einem so bestimmten Tone gesprochen, und jetzt konnte man deutlich das energische Erzittern ihrer Nasenflügel beobachten.
»Kennt der Oberst Dich vielleicht, Marion? Als Freundin darf ich Dir wohl sagen, daß Du sehr, sehr schön bist. Es ist sehr leicht möglich, daß er Dich zu besitzen wünscht, wenn er Dich einmal gesehen haben sollte.«
Die Gefragte ließ ein merkwürdig geringschätziges Lächeln um ihre schönen Lippen spielen, als sie antwortete:
»Das wäre wohl ganz und gar kein Grund, ihm meine Freiheit und Selbstständigkeit zu opfern. Wer mich einst besitzen will, der muß es verstehen, sich nicht nur meine Liebe, sondern
auch meine größte Hochachtung zu erwerben. Ich werde mich niemals verschenken.«
Sie warf den Kopf mit einer unnachahmlich stolzen Bewegung zurück. Man sah, daß sie sich ihres Werthes sehr wohl bewußt war.
»Ah! Du hast wohl gar ein Ideal?« fragte Nanon lächelnd.
»Ich habe eins, wie jedes junge Mädchen,« lautete die Antwort. »Aber ich weiß, daß dieses Ideal ein Unding, ein Phantasma ist. Aber eigenthümlich – eigenthümlich – «
Sie hielt mitten im Satze inne. Ihre vorher so selbstbewußt leuchtenden Augen nahmen plötzlich einen sinnenden Ausdruck an, mit dem sie sich durch das offene Fenster hinaus auf die Wellen richteten, welche unter dem Rade des Dampfers wild hervorschäumten, und weit ausgreifende, dunkle Wasserfurchen bildeten, deren gischtgekrönte Wände die diamantenen Reflexe des Sonnenlichtes zurückwarfen.
»Was?« fragte die Freundin. »Was ist eigenthümlich?«
Marion strich sich mit der Hand leise über die Stirn und antwortete langsam:
»Es ist eigenthümlich, ja sogar wunderbar, daß ich einen Mann gesehen habe, welcher ganz genau den Körper, das Aeußere meines Ideales besitzt. Die Seele freilich wird dann desto unähnlicher sein. Ich war fast erschrocken, als ich die Gestalt, von welcher ich so oft geträumt hatte, plötzlich in Wirklichkeit erblickte.«
»Das ist allerdings fast ein Wunder zu nennen. Du bist glücklich, liebe Marion. Wenn doch auch ich einmal die Incarnation meines Ideals sehen könnte! Aber sag, wo hast Du den Mann gesehen, und wer war er?«
»Es war in Dresden und er war Officier. Ich fuhr nach dem berühmten Blasewitz, welches Schiller durch seine »Gustel« verewigt hat, und begegnete da auf der Straße einer kleinen Truppe von Offizieren. Sie jagten an meinem Wagen vorüber, schnell wie Phantome, und doch sah ich das Bild meiner Träume unter ihnen – es war dabei.«
»Wie interessant, wie romantisch, liebe Marion, hast Du ihn wiedergesehen?«
»Ihn nicht; aber – sein Bild.«
»Ach! Erzähle! Du hast Dich vielleicht nach ihm erkundigt?«
»Wie wäre dies möglich gewesen? Uebrigens erwartetest Du mich in Berlin; ich hatte Eile. Aber Du weißt, daß ich mich in Berlin photographiren ließ. Ich mußte einige Augenblicke warten; ich befand mich ganz allein im Atelier; ich betrachtete die Porträts und Landschaften, welche da an den Wänden hingen und auf den Tischen lagen. Da – da erblickte ich sein Bild. Er war es, ganz genau getroffen, genau so stolz und schön, genau in derselben Ulanenuniform, wie er in Dresden an mir vorübergestürmt war. Sein Bild hatte Visitenkartenformat; es war Brustbild; es lagen einige Dutzend Exemplare auf einem Häufchen beisammen auf dem Tische – «
»Welch glücklicher Umstand!« rief Nanon. »Weißt Du, was ich an Deiner Stelle gethan hätte?«
»Jedenfalls dasselbe, was ich that,« lächelte Marion. »Ich war allein; Niemand sah es – ich wurde zur Diebin; ich stahl eine der Karten und steckte sie zu mir.«
Da schlug Nanon fröhlich behend die Hände zusammen und frohlockte:
»So werde auch ich Dein Ideal zu sehen bekommen! Welch eine durchtriebene Spitzbübin doch diese stolze, kühle Marion ist! Du hast Dir die Photographie doch heilig aufbewahrt?«
»Das versteht sich!«
»O, wenn Du sie doch bei Dir hättest! Ich vergehe vor Neugierde, vor Sehnsucht, das schöne Traumbild, daß sich so unverhofft verkörpert hat, zu sehen.«
Ihre Augen richteten sich mit wirklicher Begierde auf Marion's Hände, welche nach dem bereits erwähnten Täschchen gegriffen, um dasselbe zu öffnen und die dort verborgene Karte hervorzuziehen.
»Du hast sie? Sie ist da?« fuhr sie fort. »Nun sollte noch sein Name dabei stehen; denn Du konntest den Photographen unmöglich nach demselben fragen, da er sonst ja gewußt hätte, wer den Raub begangen hat.«
»Der Name steht auf der Rückseite,« bemerkte Marion. »Hier hast Du sie!«
Nanon griff mit größter Schnelligkeit zu. Sie drehte sich leicht seitwärts, damit das Licht voll auf das Bild fallen könne und betrachtete es, indem ihr Gesichtchen eine ungeheure Spannung verrieth. Sie hielt die Karte abwechselnd nahe und entfernt, um sich ein genaues Urtheil zu bilden, und sagte dann:
»Ein schöner, ein herrlicher Kopf!«
»Nicht wahr?« bemerkte Marion mit leuchtenden Augen.
»Und der Name?« Nanon drehte die Karte um und las: »Rittmeister Richard von Königsau. Auch ein schöner Name. Nicht, Marion?«
Die Gefragte nickte leise mit dem Kopfe und sagte:
»Und eigenthümlich ist es, daß ich meinem Ideale stets auch den Namen Richard gegeben habe. Richard Löwenherz ist mir der liebste Held der Geschichte, und Richard ist mir der liebste Mannesname.«
»Ich stelle mir Richard Löwenherz allerdings anders vor, als diesen Rittmeister. Ich möchte diesen Letzteren doch lieber mit dem Recken Hüon in Wieland's Oberon vergleichen. Diese Stirn, dieses Auge, dieser Mund, dieses ganze Gesicht, man muß es beim ersten Anblick lieben. Ich verstehe nichts, gar nichts von Physiognomik; ich lasse am liebsten mein Herz, mein Gefühl, meine Ahnung entscheiden.«
»Nun, was sagt Dir Deine Ahnung? Wie beurtheilt sie ihn, liebe Nanon?«
»Dieser Mann ist selbstbewußt, aber nicht adelsstolz; sein starker Körper birgt ein tiefes Gemüth, er ist kühn und verwegen, scheint mir aber auch auf dem Felde der List ein gefährlicher Gegner zu sein. Seine Stirn ist die eines geübten Denkers, und sein Mund scheint mir der Rede mächtig zu sein, schwelgende Beobachtung jedoch vorzuziehen. Sein Naturell ist jedenfalls, um mich der wissenschaftlichen Ausdrücke zu bedienen, ein cholerisch-phlegmatisches; das heißt, er ist heiß- aber langsamblütig, er fühlt und empfindet tief, läßt sich aber von der Gewalt des Augenblicks nicht beherrschen.«
Da nahm Marion mit einem erfreuten, melodischen Lachen rasch das Bild aus der Hand und sagte:
»Halte ein! Du beschreibst ihn ja als ein wahres Wunder! Wenn er wirklich so ist, wie Du ihn beurtheilst, so gliche er meinem Ideale ganz genau, und ich müßte es sehr bedauern, daß ich über die Familie der Königsau nichts,
gar nichts erfahren konnte, obgleich ich Dir aufrichtig gestehe, daß ich mir alle mögliche Mühe gegeben habe.«
»Du brauchtest Dir ja nur den Gothaer Adelskalender zu kaufen!«
»Er war nicht vorräthig, und ich bestellte ihn mir. Da aber rief mich der Brief des Vaters ab, und ich mußte Ordre geben, mir den Kalender nachzuschicken. Bis ich ihn erhalte, habe ich mich in Geduld zu fassen. Ah, wie schade!«
Diese letzten Worte wurden leise gesprochen. Sie galten dem Grafen, welcher gerade in diesem Augenblicke in die Cajüte trat, um zu sehen, ob sich hier ein Gesicht finde, welches werth sei, geküßt zu werden. Als er die beiden Damen erblickte, drückten seine Mienen ein schlecht verborgenes Erstaunen aus; er machte eine tiefe Verbeugung und zog sich schnell wieder zurück. Draußen auf der Treppe murmelte er:
»Die Baronesse de Sainte-Marie! Da wäre eine kleine, liebenswürdige Zudringlichkeit am unrechten Platz. Sie versteht es, sich unnahbar zu halten.«
Er kehrte auf das Deck zurück.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.