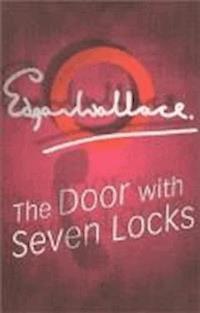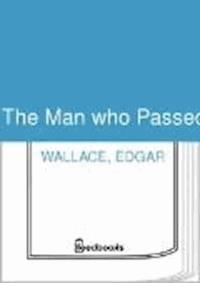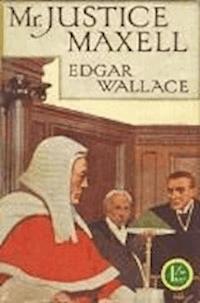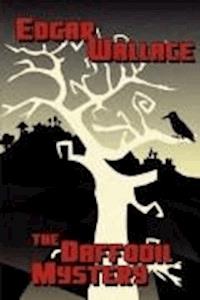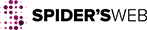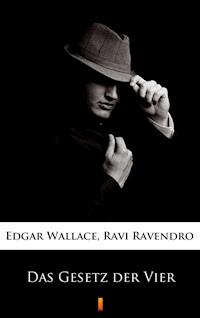
Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
DO 50% TANIEJ: JUŻ OD 7,59 ZŁ!
Aktywuj abonament i zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego, aby zamówić dowolny tytuł z Katalogu Klubowego nawet za pół ceny.
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: KtoCzyta.pl
- Kategoria: Kryminał
- Język: niemiecki
„Das Gesetz der Vier” ist die Fortsetzung von „Die vier Gerechten”, in der die gleichnamige Vereinigung von Rächern für Gerechtigkeit kämpfen, wo Polizei und Justiz nicht können oder wollen, sind zwar nur noch zu zweit – nichtsdestotrotz kämpfen sie mit vollem Einsatz für ihre Fälle. Wenn das Gesetz des Staates Verbrecher nicht mehr belangen kann dann schlägt die Stunde der Vier Gerechten. Mit genialen und umsichtigen Plänen bestrafen die Vier Gerechten, kaltblütige Mörder, gemeine Erpresser und skrupellose Menschenhändler. Lose Weiterführung der Ereignisse aus Die vier Gerechten. „Das Gesetz der Vier” erschien erstmals 1921 unter dem Titel „The Law of the Four Just Men”. Jedes Kapitel ist eine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 270
Podobne
Edgar Wallace, Ravi Ravendro
Das Gesetz der Vier
Warschau 2017
Inhalt
1. Der Mann von Clapham
2. Der Mann mit den grossen Eckzähnen
3. Der Mann, der die Regenwürmer haßte
4. Der Mann, der zweimal starb
5. Der Mann, der Amelia Jones haßte
6. Der Mann, der glücklich war
7. Der Mann, der Musik liebte
8. Der Mann, der sein Vermögen verspielte
9. Der Mann, der nicht sprechen wollte
10. Der Mann, der freigesprochen wurde
1
Der Mann von Clapham
»Die Verteidigung hat behauptet, Mr. Noah Stedland sei ein Erpresser und habe infolge seiner Drohungen eine große Summe von dem Angeklagten erhalten. Der Gerichtshof kann diese unbewiesene Behauptung nicht ohne weiteres annehmen, besonders da die Aussagen des Angeklagten nicht unter Eid geleistet wurden. Sie wurden zwar beim Zeugenverhör erwähnt, es konnte aber nicht der geringste Beweis dafür erbracht werden. Die Verteidigung hat nicht einmal gesagt, welche Art von Drohung Mr. Stedland anwandte...«
Die glänzende Rede des Staatsanwalts machte den besten Traditionen des Gerichtes Ehre, und die Geschworenen einigten sich auf »Schuldig«, ohne sich zu einer längeren Beratung zurückzuziehen.
Eine Bewegung ging durch den Gerichtssaal, und man hörte ein Raunen und Flüstern, als der Richter seine Hornbrille aufsetzte und zu schreiben begann.
Der Angeklagte saß hinter den großen, eichenen Schranken und schaute ermutigend eine junge Frau an, die ihm ihr Gesicht zuwandte. Er war bei dem Spruch der Geschworenen nicht erbleicht und richtete jetzt den ernsten Blick wieder auf die Gestalt des Richters, der in einem braunroten Talar und einer weißen Perücke dort oben saß und so eifrig am Schreiben war. Er wunderte sich, was ein Richter unter diesen Umständen wohl schreiben mochte. Ob er den ganzen Tatbestand noch einmal kurz zusammenfaßte? Der Angeklagte war ungeduldig. Nachdem sein Schicksal besiegelt war, hatte er nur noch den einen Wunsch, möglichst bald mit allem fertig zu sein; der Aufenthalt in diesem großen, hohen Gerichtssaal, aus dem ihm viele verschwommene Reihen von Gesichtern entgegenstarrten, war qualvoll. Er konnte den Anblick des gleichgültigen Verteidigers und vor allem der beiden Männer nicht mehr ertragen, die in der Nähe des Rechtsanwaltes saßen und ihn scharf beobachteten.
Er hätte gern gewußt, wer sie waren und welches Interesse sie an dem Ausgang dieses Prozesses hatten. Vielleicht waren es Schriftsteller aus dem Ausland, die hier Eindrücke sammeln wollten. Sie hatten jedenfalls ein fremdländisches Aussehen. Der eine war sehr groß (das hatte er bemerkt, als er einmal aufgestanden war), der andere war klein und hager und sah fast wie ein Jüngling aus, obgleich sein Haar schon ergraut war. Beide waren glattrasiert, trugen schwarze Anzüge und hielten breitkrempige, weiche, schwarze Filzhüte auf ihren Knien.
Ein Räuspern des Richters störte den Angeklagten in seinen Betrachtungen.
»Jeffrey Storr«, sagte der Richter, »auch ich bin mit dem Spruch der Geschworenen durchaus einverstanden. Sie behaupten, daß Stedland Sie um Ihre Ersparnisse gebracht habe und daß Sie in sein Haus einbrachen, um die Bestrafung dieses Mannes selbst in die Hand zu nehmen und Ihr Geld und ein Schriftstück wieder zu erhalten. Sie sind zwar nicht näher auf den Charakter dieses Schriftstückes eingegangen, haben aber vorgebracht, daß es die Schuld Mr. Stedlands beweisen würde. Solche Behauptungen können nicht ernstlich von einem Gerichtshof in Betracht gezogen werden. Ihre Geschichte klingt so, als ob Sie von diesen berühmten, besser, berüchtigten Leuten gelesen hätten, die man die ›Vier Gerechten‹ nennt. Sie trieben ihr Wesen vor einigen Jahren, aber nun ist ihrer Tätigkeit glücklicherweise Einhalt geboten. Sie hatten sich die Aufgabe gesetzt, dort zu strafen, wo das Gesetz versagte. Es ist eine maßlose Überheblichkeit, anzunehmen, daß das Gesetz jemals versagt. Sie haben ein verdammenswertes Verbrechen begangen, und besonders der Umstand, daß Sie im Augenblick Ihrer Verhaftung im Besitz einer geladenen Schußwaffe waren, fällt bei der Beurteilung Ihrer Tat erschwerend ins Gewicht. Ich verurteile Sie zu sieben Jahren Zuchthaus.«
Jeffrey Storr verneigte sich, und ohne noch einen Blick auf die junge Frau zu werfen, wandte er sich kurz um und stieg die Stufen hinunter, die zu den Zellen führten.
Die beiden fremdländisch aussehenden Herren, die das Interesse und den Unwillen des Angeklagten erregt hatten, waren die ersten, die den Saal verließen.
Als sie auf der Straße angelangt waren, blieb der Größere der beiden stehen.
»Wir wollen auf die Frau warten«, sagte er.
»Ist er mit ihr verheiratet?« fragte der Kleinere.
»Ja, sie haben in der Woche geheiratet, in der er törichterweise sein Geld fortgab. Es war doch ein merkwürdiger Zufall, daß der Richter gerade heute die ›Vier Gerechten‹ erwähnte.«
Der andere lächelte.
»In demselben Gerichtssaal wurdest du zum Tode verurteilt, Manfred.«
»Ich war neugierig, ob sich der alte Gerichtsdiener noch auf mich besinnen würde. Man sagt, daß er kein Gesicht vergißt, das er einmal gesehen hat, selbst nach vielen Jahren nicht. Aber scheinbar hat es Wunder gewirkt, daß ich meinen Bart abnahm. Ich habe den Mann sogar angeredet, ohne daß er etwas merkte. Aber hier kommt sie.«
Glücklicherweise war die junge Frau allein. Ein schönes Gesicht, dachte Gonsalez, der Jüngere von beiden. Sie trug den Kopf hoch und stolz und weinte nicht. Gonsalez und Manfred folgten ihr zur Newgate Street, und als sie die Straße nach Hatton Garden überquerte, redete Manfred sie an.
»Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Storr.«
Sie wandte sich um und sah den Fremden argwöhnisch an.
»Wenn Sie ein Reporter sind –«, begann sie.
»Das bin ich nicht«, erwiderte Manfred lächelnd. »Auch bin ich nicht einmal ein Freund Ihres Mannes, obgleich ich eigentlich vorhatte, Ihnen das vorzulügen. Dann hätte ich wenigstens eine Entschuldigung dafür gehabt, daß ich Sie hier auf der Straße anspreche.«
Seine Offenherzigkeit machte Eindruck auf sie.
»Ich möchte nicht über Jeffrey sprechen«, sagte sie. »Ich habe nur den einen Wunsch, allein zu sein.«
»Das kann ich verstehen«, meinte er mitfühlend. »Aber ich wünschte, ich wäre ein Freund Ihres Mannes, vielleicht könnte ich ihm helfen. Die Geschichte, die er vor Gericht erzählte, ist wahr – das ist doch auch deine Ansicht, Leon?«
»Sie ist ganz bestimmt wahr«, bestätigte Gonsalez. »Ich habe besonders seine Augenlider betrachtet. Wenn ein Mann lügt, zwinkert er bei jeder Wiederholung seiner unwahren Behauptung. Hast du noch nicht bemerkt, George, daß Männer nicht lügen können, wenn ihre Hände zusammengepreßt sind, daß aber Frauen die Hände dabei falten?«
Mrs. Storr sah Gonsalez verwirrt an. Sie war nicht in der Stimmung, einen Vortrag über die Physiologie des Ausdrucks über sich ergehen zu lassen. Selbst wenn sie gewußt hätte, daß Leon Gonsalez der Verfasser dreier großer Bücher war, die sich den besten Werken Lombrosos oder Mantegazzas an die Seite stellten, hätte sie ihm nicht zugehört.
Manfred unterbrach seinen Freund.
»Wir glauben wirklich, Mrs. Storr, daß wir Ihren Mann befreien und seine Unschuld beweisen können. Aber wir müssen soviel Material über den Fall sammeln, wie es nur möglich ist.«
Sie zögerte einen Augenblick.
»Ich wohne in der Grays Inn Road – vielleicht haben Sie die Güte, mich zu begleiten...
Mein Rechtsanwalt glaubt nicht, daß es Zweck hat, Berufung einzulegen«, fuhr sie fort, als die beiden Freunde sie in die Mitte genommen hatten und neben ihr hergingen.
Manfred schüttelte den Kopf.
»Das Berufungsgericht würde das Urteil nur bestätigen«, sagte er ruhig. »Wenn Sie keine anderen Beweise vorbringen können als heute, ist es unmöglich, Ihren Mann zu retten.«
Sie sah ihn enttäuscht an, und er merkte, daß sie den Tränen nahe war.
»Ich dachte... Sie sagten doch...?« begann sie unsicher.
Manfred nickte. »Wir kennen Stedland und –«
»Das Merkwürdigste an Erpressern ist doch, daß die Schädelerhöhung am Eintrittspunkt des Okziptalnervs bei ihnen kaum bemerkbar ist«, unterbrach Gonsalez die Unterhaltung nachdenklich.
»Mein Freund ist eine Autorität auf dem Gebiet der Schädelkunde.« George Manfred lächelte entschuldigend. »Ja, wir kennen Stedland. Seine Verbrechen sind uns von Zeit zu Zeit berichtet worden. Erinnerst du dich an den Fall Wellingford, Leon?«
Gonsalez nickte.
»Dann sind Sie wohl Detektive?« fragte Mrs. Storr.
Manfred lachte leise.
»Nein, wir sind keine Detektive – wir interessieren uns nur für Verbrechen. Ich glaube, wir haben die besten und vollständigsten Akten in der ganzen Welt über Verbrecher, die nicht bestraft wurden.«
Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinander her.
»Stedland ist ein böser Mensch.« Gonsalez nickte, als ob ihm erst jetzt diese Erleuchtung gekommen wäre. »Hast du seine Ohren beobachtet? Sie sind ungewöhnlich lang, und die äußeren Ränder sind zugespitzt. Es sind richtige Verbrecherohren!«
Die Wohnung von Mrs. Storr war klein, notdürftig eingerichtet und zeigte das typische Aussehen möblierter Mietsräume. Manfred sah sich in dem engen Speisezimmer um.
Die junge Frau, die Mantel und Hut abgelegt hatte, kam jetzt zurück und setzte sich zu den beiden Freunden, die sie schon gebeten hatte, Platz zu nehmen.
»Es wird mir klar, daß ich dabei bin, mein Geheimnis zu verraten«, sagte sie mit einem schwachen Lächeln. »Aber ich fühle, daß Sie mir wirklich helfen wollen, und ich habe merkwürdigerweise auch die Überzeugung, daß Sie es können. Die Polizeibeamten waren recht freundlich zu uns und haben uns geholfen, wo sie konnten. Wahrscheinlich hatten sie Mr. Stedland schon seit längerer Zeit im Verdacht und hofften, daß wir ihnen die nötigen Beweise zu seiner Überführung liefern könnten. Als sich diese Hoffnung aber nicht erfüllte, blieb ihnen nichts anderes übrig, als Anklage gegen meinen Mann zu erheben. Was soll ich Ihnen nun erzählen?«
»Die Geschichte, die vor Gericht verschwiegen wurde«, erwiderte Manfred.
Sie war einige Zeit ruhig und sammelte sich.
»Nun gut, ich will Ihnen alles mitteilen«, sagte sie dann. »Bis jetzt kennt nur der Rechtsanwalt meines Mannes den wahren Sachverhalt. Aber ich glaube, daß auch er daran zweifelt. Und wenn er uns nicht einmal glaubt«, rief sie verängstigt, »wie kann ich erwarten, Sie zu überzeugen?«
»Haben Sie keine Sorge, Mrs. Storr, wir sind schon überzeugt«, entgegnete Gonsalez, der sie interessiert angesehen hatte. Manfred nickte.
Wieder entstand eine Pause. Es fiel ihr sichtlich schwer, mit ihrem Bericht zu beginnen, und Manfred vermutete, daß sie irgendwie dadurch bloßgestellt wurde. Diese Annahme bestätigte sich auch.
»Als junges Mädchen besuchte ich eine große Töchterschule in Sussex; ich glaube, es waren mehr als zweihundert Schülerinnen dort. Ich will mich keineswegs für irgend etwas entschuldigen, was ich damals tat«, fuhr sie schnell fort. »Ich verliebte mich in einen jungen Burschen – er war der Sohn eines Fleischers! Das klingt schrecklich, nicht wahr? Aber Sie müssen bedenken, daß ich noch ein Kind und sehr empfänglich für alles Neue und Ungewöhnliche war – ach, ich weiß, es ist fürchterlich, aber ich traf ihn gewöhnlich nach der Andacht in dem Garten hinter dem großen Versammlungssaal. Er stieg immer über die Mauer, und wir plauderten dann miteinander, manchmal eine ganze Stunde lang. Es war aber nur eine Mädchenschwärmerei, und ich weiß wirklich nicht, warum ich damals eine solche Dummheit beging.«
»Mantegazza erklärt derartige Dinge sehr genau in seiner ›Psychologie der Liebe‹«, sagte Leon Gonsalez halb für sich. »Aber verzeihen Sie, daß ich Sie unterbrochen habe.«
»Es war weiter nichts als eine Freundschaft zwischen Kindern. Ich sah zu ihm auf wie zu einem Helden und hielt ihn für den Inbegriff aller Männlichkeit. Er muß auch wirklich der beste und schönste aller Fleischerjungen gewesen sein«, meinte sie lächelnd. »Er hat mir niemals ein böses Wort gesagt und war immer sehr gut zu mir. Unsere Freundschaft hörte nach einem oder zwei Monaten von selbst wieder auf, und die ganze Geschichte wäre damit zu Ende gewesen, wenn ich nicht so töricht gewesen wäre, Briefe an ihn zu schreiben. Es waren ganz gewöhnliche, dumme Liebesbriefe, sie waren auch ganz unschuldig – wenigstens erschienen sie mir damals so. Wenn ich sie allerdings heute, von meinem jetzigen Standpunkt aus, lese, bleibt mir der Atem weg, was ich damals alles geschrieben habe.«
»Dann haben Sie die Briefe also noch?« fragte Manfred.
»Nein. Ich meinte eigentlich nur einen bestimmten Brief, und auch davon besitze ich nur eine Kopie, die mir Mr. Stedland gegeben hat. Dieser eine Brief, der nicht vernichtet wurde, fiel nämlich in die Hände der Mutter des Jungen. Sie war sehr aufgebracht und trug ihn zu der Hauptlehrerin, die viel Aufhebens davon machte. Sie drohte mir, an meine Eltern zu schreiben, die damals in Indien waren. Als ich aber feierlich versprach, unserer Freundschaft ein Ende zu machen, beruhigte sie sich und vertuschte die Sache schließlich. Wie der Brief in Stedlands Besitz kam, weiß ich nicht. Ich hörte von diesem Mann erst eine Woche vor meiner Hochzeit. Jeff hatte ungefähr zweitausend Pfund erspart, und wir waren gerade im Begriff, uns zu verheiraten, als uns plötzlich dieser Schlag wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf. Ich erhielt einen Brief von einem ganz unbekannten Mann, in dem ich aufgefordert wurde, ihn in seinem Büro aufzusuchen. So kam ich zum erstenmal mit diesem Schuft in Berührung. Seinen Brief sollte ich zu der Unterredung wieder mitbringen. Ich war neugierig, was er von mir wollte und ging tatsächlich nach seinem kleinen Büro in der Nähe der Regent Street. Ich brauchte nicht lange auf die Aufklärung zu warten. Nachdem er mir sein Schreiben wieder abgenommen hatte, erklärte er mir freiheraus, warum er mich bestellt hatte.«
Manfred nickte.
»Er wollte Ihnen natürlich den Brief verkaufen – wieviel verlangte er?«
»Zweitausend Pfund. Das war ja die teuflische Gemeinheit«, sagte die junge Frau heftig erregt. »Er wußte fast auf den Pfennig genau, wieviel Jeff sich erspart hatte.«
»Hat er Ihnen damals den Brief gezeigt?«
»Nein, nur eine Fotokopie davon, und als ich den Brief dann wieder las und zu meinem Schrecken gewahr wurde, welche Schlußfolgerungen man aus diesem unschuldigen Schreiben ziehen konnte, packte mich ein furchtbares Entsetzen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als Jeff alles zu sagen, denn Mr. Stedland hatte gedroht, Fotokopien des Briefes an alle unsere Freunde und an Jeffreys Onkel zu schicken, der meinen Mann zum einzigen Erben eingesetzt hatte. Zum Glück wußte Jeffrey schon alles, was sich damals in der Schule zugetragen hatte, und ich brauchte deshalb seinen Argwohn und Verdacht nicht zu fürchten. Jeffrey ging zu Stedland, und ich glaube, daß sie in heftigen Streit gerieten. Aber Stedland ist trotz seiner Jahre ein großer, starker Mann, und Jeffrey unterlag in dem Kampf. Das Ende der Sache war, daß Jeff versprach, den Brief für zweitausend Pfund unter der Bedingung zu kaufen, daß Stedland ihm auf eine leere Seite des Schreibens eine Quittung über diese Summe gab. Das bedeutete den Verlust all seiner mühsamen Ersparnisse, es bedeutete auch die Verzögerung unserer Verheiratung. Aber Jeffrey wollte sein Versprechen unter allen Umständen halten. Mr. Stedland wohnt in einem großen Haus in der Nähe von Clapham Common –«
»148 Park View West«, unterbrach Manfred.
»Sie wissen es?« fragte sie erstaunt. »Ja, dorthin mußte Jeffrey gehen, um das Geschäft abzuschließen. Mr. Stedland öffnete die Haustür selbst und führte Jeff zu seinem Arbeitszimmer im ersten Stock. Mein Mann erkannte, daß es nutzlos war, mit diesem Menschen noch zu rechten oder ihn zu bitten, und bezahlte das Geld nach Stedlands Anweisung in amerikanischen Banknoten –«
»Die natürlich viel schwieriger zu verfolgen sind«, warf Manfred dazwischen.
»Dann holte Stedland den Brief, schrieb die Quittung auf die leere Seite, löschte sie ab und legte das Schreiben in einen Umschlag, den er meinem Mann gab. Als Jeffrey zu Hause das Kuvert öffnete, fand er nur einen leeren Briefbogen darin.«
»Der Betrüger hat ihn übers Ohr gehauen«, sagte Manfred.
»Denselben Ausdruck gebrauchte auch Jeffrey. Und nun entschloß er sich zu dieser verzweifelten, wahnsinnigen Tat. Sie haben doch sicher schon von den ›Vier Gerechten‹ gehört?«
»Ja, ich habe von ihnen gehört«, antwortete Manfred ernst.
»Mein Mann glaubt an ihre Methoden und bewundert sie sehr. Er hat wohl alles gelesen, was jemals über sie geschrieben wurde. Eines Abends, zwei Tage nach unserer Hochzeit – ich hatte darauf bestanden, daß wir uns sofort trauen ließen, nachdem ich die Lage überschaute –, kam er zu mir und sagte: ›Grace, ich werde jetzt die Methoden der Vier Gerechten gegen Stedland anwenden.‹ Er weihte mich in seine Pläne ein. Offenbar hat er Stedlands Haus genau beobachtet und ausgekundschaftet, denn er wußte, daß außer Stedland und seinem Diener niemand dort schlief. Er hatte sich einen Plan ausgedacht, wie er in das Haus kommen konnte. Mein armer Jeffrey – er hatte als Einbrecher wenig Erfolg. Sie haben ja heute gehört, wie es ihm schließlich gelang, in Stedlands Zimmer einzudringen. Er hat wohl gehofft, den Mann mit seinem Revolver einzuschüchtern.«
Manfred schüttelte den Kopf.
»Stedland ist einer der bekanntesten und gefürchtetsten Revolverhelden in Südafrika gewesen. Er ist der gewandteste und schnellste Schütze, den ich kenne, und er trifft unfehlbar. Natürlich hat er Ihren Mann sofort mit seinem Revolver bedroht, bevor der überhaupt seine Tasche erreichen konnte, um die eigene Waffe zu ziehen.«
»Das ist meine Geschichte«, sagte Mrs. Storr ruhig. »Wenn Sie Jeff helfen können, werde ich Ihnen mein ganzes Leben lang dankbar sein.«
Manfred erhob sich langsam.
»Es war ein wahnsinniges Unternehmen. Ihr Mann hätte sich sagen sollen, daß Stedland ein ihn so belastendes Dokument nicht in seiner Wohnung aufbewahren würde, da er doch mindestens sechs Stunden am Tag nicht zu Hause ist. Vielleicht war der Brief auch vernichtet, obwohl das unwahrscheinlich ist. Stedland wird ihn zu späterem Gebrauch aufgehoben haben. Erpresser sind große Menschenkenner, und er weiß, daß er aus Ihrem Brief noch Geld machen kann. Aber sollte dieser Brief noch existieren –«
»Sollte er noch existieren...«, wiederholte sie mit zitternden Lippen. Sie hatte sich lange tapfer aufrecht gehalten, aber nun kam die Reaktion.
»Dann wird er in einer Woche in Ihren Händen sein«, sagte Manfred, und mit diesem Versprechen verabschiedeten sich die beiden von ihr.
*
Mr. Noah Stedland hatte das Gerichtsgebäude an diesem Nachmittag nicht in der besten Stimmung verlassen. Er war nur damit zufrieden, daß er das Haus durch den allgemeinen Ausgang verlassen konnte und nicht in eine der Gefängniszellen abgeführt worden war. Er ließ sich nicht leicht erschrecken, aber er war empfänglich für gewisse Unterströmungen. Es schien ihm, daß die sorgfältig gewählten Worte des Richters weniger nach dem Wortlaut als nach dem Ton eine versteckte Anklage gegen ihn selbst enthielten. Aber auch nachdem er sich darüber klargeworden war, verließ ihn das drückende Gefühl nicht. Er besaß ein beträchtliches Vermögen, das er bei verschiedenen Gelegenheiten zusammengerafft hatte. Manchmal war es plötzlich um bedeutende Summen angewachsen. Er war in seinen Unternehmungen immer erfolgreich gewesen, da er sich niemals von der Stimme des Gewissens oder des Mitleids hatte beeinflussen lassen. Das Leben war für diesen großen, breitschultrigen Mann mit der fahlen Gesichtsfarbe weiter nichts als ein Spiel. Und Jeffrey Storr, gegen den er persönlich keinen Groll hegte, hatte in diesem Spiel eben verloren.
Stedland konnte ohne die geringste Erregung daran denken, daß Storr nun in Sträflingskleidern lange Jahre ein schreckliches Leben im Gefängnis führen mußte. Derartige Vorstellungen riefen kein anderes Gefühl in ihm hervor als das eines Spielers, der den Zusammenbruch seines Gegners gelassen und gleichgültig beobachtet.
Er öffnete die Tür seines schmalen Hauses selbst und schloß sie wieder, indem er den Schlüssel zweimal umdrehte. Dann stieg er die mit einem abgetretenen Läufer bedeckte Treppe hinauf und ging in sein Arbeitszimmer. Die Geister der armen Menschen, deren Leben er vernichtet hatte, hätten ihm den Aufenthalt in diesem Raum unerträglich machen müssen, aber Mr. Stedland glaubte nicht an Geister. Er fuhr mit dem Finger über die staubige Platte eines Mahagonitisches und schimpfte über die gutbezahlte Aufwartefrau, die für diese Nachlässigkeit verantwortlich war.
Er hielt eine große Zigarre zwischen seinen goldplombierten Zähnen, lehnte sich in seinen Sessel zurück und versuchte wieder, sich über dieses merkwürdige Gefühl klarzuwerden, das ihn in dem Gerichtssaal gequält hatte. Weder die Haltung des Richters noch die heftigen Angriffe des Verteidigers beschwerten ihn, ebensowenig die Möglichkeit, daß die Mitwelt ihn verurteilen könnte. Auch das Los des Verurteilten oder der bleichen, abgehärmten Frau bedrückte ihn nicht. Und doch war er ängstlich geworden und hatte sich unruhig umgesehen.
Als er eine halbe Stunde lang in Gedanken versunken geraucht hatte, läutete die Glocke an der Haustür, und er ging hinunter, um zu öffnen. Der Mann, der vor der Tür stand, lächelte verlegen. Er war der Angestellte Mr. Stedlands und versah zu gleicher Zeit alle Pflichten vom Hausmeister bis zum Laufburschen für seinen Herrn.
»Komm herein, Jope«, sagte Mr. Stedland und schloß die Tür hinter ihm. »Geh in den Keller und bringe mir eine Flasche herauf.«
»Wie waren Sie mit meiner Aussage zufrieden?« Der Diener grinste erwartungsvoll.
»Verrückter Kerl!« brummte Stedland. »Was sollte denn das, daß du sagst, du hättest mich um Hilfe rufen hören?«
»Nichts für ungut, Herr, ich wollte nur die Sache für den Angeklagten ein wenig schlimmer machen«, erklärte Jope unterwürfig.
»Ich – um Hilfe rufen!« Mr. Stedland lachte höhnisch. »Denkst du denn, ich würde so einen Lumpenkerl wie dich zu Hilfe rufen? Bei einer wirklichen Prügelei würdest du ja viel nützen! Hol den Whisky!«
Als Jope kurz darauf mit einer Flasche und einem Siphon Sodawasser nach oben kam, schaute Stedland mürrisch zum Fenster hinaus. Man konnte von dort aus auf einen kleinen ungepflegten Garten sehen, der von einer hohen Mauer umgeben war. Dahinter lag ein Gelände, auf dem ein halbvollendetes Gebäude stand. Während des Baues war der Unternehmer pleite gegangen, und Mr. Stedland ärgerte sich jedesmal, wenn er die Ruine sah, denn der Grund und Boden, auf dem sie stand, gehörte ihm.
Plötzlich wandte er sich um.
»Jope, war irgend jemand im Gerichtssaal, den wir kannten?«
»Nein, Mr. Stedland«, erwiderte der Mann erstaunt. »Niemand mit Ausnahme des Polizeiinspektors –«
»Ach, den meine ich nicht«, rief Mr. Stedland ungeduldig. »Ich kannte alle Detektive, die dort waren. Hast du nicht sonst jemand gesehen, der etwas gegen uns hat?«
»Nein, Mr. Stedland. Hat es denn überhaupt etwas zu sagen, ob einer dort war?« fragte Jope kühn. »Denen sind wir doch stets gewachsen, von denen kann uns doch keiner.«
»Wie lange sind wir schon beisammen?« brummte Stedland unfreundlich, als er sich ein Glas Whisky einschenkte.
Jope lächelte schmeichlerisch.
»Nun ja, wir sind schon eine ganze Weile beieinander, Mr. Stedland.«
Der große Mann wischte sich die Lippen ab und schaute wieder zum Fenster hinaus.
»Ja, das stimmt«, sagte er nach einiger Zeit. »Es ist schon lange her. Du hättest tatsächlich deine Strafe jetzt beinahe abgesessen, wenn ich der Polizei vor sieben Jahren erzählt hätte, was ich von dir wußte –«
Jope fühlte sich unbehaglich und wechselte sofort das Gesprächsthema. Er hätte sich sagen können, daß die siebenjährige Gefängnisstrafe von Mr. Stedland in eine lebenslängliche Sklaverei umgewandelt worden war, aber so weit reichten die Gedanken Mr. Jopes nicht.
»Ist noch etwas auf der Bank zu erledigen?« fragte er diensteifrig.
»Sei doch kein Dummkopf! Die Bank schließt um drei Uhr.« Stedland wandte sich plötzlich zu ihm um. »In Zukunft mußt du in der Küche schlafen.«
»In der Küche?«
Stedland nickte bestätigend.
»Ich möchte nicht wieder von einem nächtlichen Besucher überrascht werden. Dieser Kerl war in meinem Zimmer, bevor ich wußte, was los war. Und hätte ich nicht ein Schießeisen zur Hand gehabt, so hätte er mich überwältigt. Der einzige Weg, auf dem jemand in dieses Haus einbrechen kann, führt durch die Küche, und ich habe eine Ahnung, daß in der nächsten Zeit etwas passiert.«
»Der sitzt doch jetzt im Zuchthaus.«
»Von dem rede ich doch gar nicht«, fuhr ihn Stedland an. »Ich denke, du hast jetzt begriffen, daß du dein Bett in der Küche aufschlagen sollst.«
»Es ist aber so zugig dort –« begann Jope.
»Du stellst dein Bett in der Küche auf!« schrie Stedland und schaute den Mann böse an.
»Jawohl, gewiß«, sagte Jope schnell.
Als der Diener gegangen war, zog Stedland seinen Rock aus und schlüpfte in eine fleckige Hausjacke aus Alpaka. Dann schloß er den Geldschrank auf und nahm sein Bankbuch heraus. Er setzte sich in seinen Stuhl, blätterte zufrieden die Seiten um und träumte von einer großen Plantage in Südamerika und von einem angenehmen und ruhigen Leben. Durch zwölfjährige harte Arbeit in London hatte er ein großes Vermögen zusammengebracht. Er war stets vorsichtig zu Werk gegangen und immer auf seiner Hut gewesen. Alle seine Erpressungen hatte er in geschäftsmäßiger Weise durchgeführt, so daß man ihm nichts nachweisen konnte. Sein Konto bei der Privatbank von Sir William Molbury & Co. war eins der größten. Diese Bank war in der City bekannt wegen ihrer verschwiegenen und geheimnisvollen Geschäftsführung, und aus diesem Grund hatte auch Mr. Stedland sein Konto dort eingerichtet. Außerdem gehörte Molburys Firma zu den altmodischen Banken, die stets große Reserven an barem Geld in ihren Schränken verwahren. Auch dieser Umstand kam Mr. Stedland sehr gelegen, denn er konnte immerhin einmal in die Lage kommen, seine Mittel in kürzester Zeit zusammenraffen zu müssen.
Der Abend und die Nacht gingen vorüber, ohne daß sich unangenehme Zwischenfälle ereigneten. Nur Mr. Jope hatte eine etwas heisere Stimme bekommen und meldete seinem Herrn, als er ihm am Morgen den Tee brachte, daß es über Nacht sehr kalt in der Küche gewesen sei und daß er kaum habe schlafen können.
»Nimm dir mehr Decken«, erwiderte Stedland kurz.
Nach dem Frühstück verließ er das Haus und machte sich auf den Weg nach seinem Büro in der City. Mr. Jope blieb im Haus zurück, um die Aufwartefrau bei ihren Arbeiten zu beaufsichtigen. Er teilte ihr auch im Auftrag seines Herrn mit, daß ihr Gehalt hoch genug sei und daß es sehr viele gute Aufwartefrauen ohne Beschäftigung in der Stadt gäbe. Wenn sie das Arbeitszimmer nicht besser abstauben würde, könnte es unangenehme Konsequenzen für sie haben.
Um elf Uhr vormittags kam ein gediegen aussehender, älterer Herr, der einen Zylinder trug. Jope öffnete ihm die Haustür und fragte nach seinen Wünschen.
»Ich komme von der Depositenbank«, sagte der Fremde.
»Von welcher Depositenbank?« fragte Jope argwöhnisch.
»Von der Fetter Lane Depositenbank. Ich möchte nur feststellen, ob der Herr nicht das letztemal, als er zu uns kam, seinen Schlüssel steckenließ.«
Jope schüttelte den Kopf.
»Wir haben überhaupt nichts mit Depotbanken zu tun«, sagte er mit Nachdruck. »Und außerdem würde mein Herr wohl niemals einen Schlüssel in einem Geldschrank auf der Bank steckenlassen.«
»Entschuldigen Sie, dann bin ich sicher an ein falsches Haus geraten«, meinte der ältere Herr lächelnd. »Ist dies nicht die Wohnung von Mr. Smithson?«
»Nein«, erwiderte Jope unliebenswürdig und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Der Besucher ging die Stufen zur Straße wieder hinunter und traf an der Ecke einen anderen Herrn.
»Sie haben nichts mit Depotbanken zu tun, Manfred«, sagte er.
»Das habe ich kaum angenommen«, meinte der Größere von den beiden. »Ich bin davon überzeugt, daß er alle seine Dokumente und Schriftstücke auf seiner Bank hat. Hast du den Diener Jope getroffen?«
»Ja«, erwiderte Gonsalez nachdenklich. »Der Mensch hat ein interessantes Gesicht. Schwach entwickeltes Kinn, aber ganz normale Ohren. Die Stirn flieht nach hinten, und soweit ich es beurteilen kann, ist. er ein charakteristischer Spitzschädel.«
»Armer Jope!« sagte Manfred, ohne zu lächeln. »Aber jetzt wollen wir auf das Wetter achten, Leon. Vom Golf von Biskaya rückt ein Antizyklon heran. In Eastbourne spürt man seine wohltätigen Wirkungen schon. Wenn er sich in den nächsten drei Tagen wirklich nach London hin ausbreitet, können wir Mrs. Storr gute Nachricht bringen.«
»Das glaube ich auch«, stimmte Gonsalez zu. Sie gingen zu ihrer Wohnung in der Jermyn Street zurück. »Eine Möglichkeit, diesen Kerl einfach zu überfallen, gibt es wohl nicht?«
Manfred schüttelte den Kopf.
»Ich möchte noch nicht sterben«, sagte er, »und ich würde bestimmt mit meinem Lebensende rechnen müssen, denn Noah Stedland ist ein ungemütlich schneller und genauer Schütze.«
Manfreds Prophezeiung ging zwei Tage später in Erfüllung. Der Einfluß des Antizyklons dehnte sich über London aus, und ein dünner, gelber Schleier breitete sich über die Stadt. Am Nachmittag heiterte sich das Wetter auf, wie Manfred zufrieden feststellte. Doch schien es, als ob sich der Nebel nicht vor Einbruch der Nacht zerstreuen würde.
Mr. Stedlands Büro in der Regent Street war nur klein, aber sehr gut eingerichtet. Auf der Glastür stand unter seinem Namen das bedeutungsvolle Wort: Finanzier. Tatsächlich war Stedland auch als Geldverleiher ins Handelsregister eingetragen. Dieses Geschäft war sehr einträglich und vorteilhaft für ihn, denn was Stedland, der Geldverleiher, an Geheimnissen erfuhr, konnte der Erpresser Stedland ausnützen. Es war keine ungewöhnliche Erscheinung, daß Mr. Stedland Summen zu hohen Prozentsätzen auslieh, die zur Zahlung seiner eigenen erpresserischen Forderungen bestimmt waren. Auf diese Weise konnte er einen doppelten Druck auf seine Opfer ausüben.
Nachmittags meldete sein Clerk einen Besucher an.
»Ein Herr oder eine Dame?«
»Ein Herr«, erwiderte der Angestellte. »Ich glaube, er ist von der Molbury-Bank.«
»Kennen Sie ihn?«
»Nein, aber er kam schon gestern, als Sie fortgegangen waren, und fragte, ob Sie die Bankabrechnung bekommen hätten.«
Mr. Stedland nahm eine Zigarre aus der Kiste, die auf dem Tisch stand, und zündete sie an.
»Führen Sie ihn herein«, sagte er dann.
Er erwartete nichts Aufregenderes, als daß ihm der nichthonorierte Scheck eines seiner Kunden präsentiert würde.
Der Mann, der ins Zimmer trat, war offensichtlich in großer Erregung. Er schloß die Tür hinter sich zu und blieb dann stehen, während er nervös mit seinem Hut spielte.
»Nehmen Sie Platz«, sagte Stedland. »Nehmen Sie auch eine Zigarre, Mr. –«
»Curtis«, erwiderte der andere heiser. »Danke sehr, ich bin Nichtraucher.«
»Nun, was kann ich für Sie tun?«
»Ich möchte Sie kurz in einer privaten Angelegenheit sprechen.« Bei diesen Worten schaute er ängstlich auf die Glastür, die Mr. Stedlands Büro von dem kleinen Raum trennte, in dem seine Angestellten arbeiteten.
»Sie können ganz unbesorgt sein«, meinte Stedland belustigt. »Ich kann Ihnen dafür garantieren, daß die Scheidewand schallsicher ist. Was haben Sie denn für Sorgen?«
Er vermutete, daß der Mann in einer augenblicklichen Geldverlegenheit steckte, und ein Bankbeamter in solcher Lage konnte sehr nützlich für die Zukunft sein.
»Ich weiß kaum, wie ich anfangen soll, Mr. Stedland«, sagte der Mann und setzte sich schüchtern auf die Ecke eines Stuhles. Sein Gesicht zuckte nervös. »Es ist eine schreckliche Geschichte, einfach furchtbar.«
Stedland hatte schon oft von solchen furchtbaren Dingen gehört. Manchmal bedeuteten sie nicht mehr, als daß sein Besucher vom Gerichtsvollzieher bedroht und ängstlich bemüht war, seinen Arbeitgeber nichts davon erfahren zu lassen. Zuweilen waren die Geständnisse auch schwererer Art.
»Erzählen Sie mir nur alles«, sagte er aufmunternd. »Mich können Sie nicht so leicht aus der Fassung bringen!«
Diese Äußerung war jedoch ein wenig voreilig.
»Ich bin nicht meinetwegen so in Sorge, sondern wegen meines Bruders John Curtis, der seit zwanzig Jahren Kassierer bei der Bank ist«, erwiderte der Mann aufgeregt. »Ich hatte nicht die geringste Ahnung, daß er in Schwierigkeiten war, aber er hat an der Börse spekuliert und hat es mir erst heute gesagt. Es ist entsetzlich – ich fürchte, er wird sich das Leben nehmen. Er ist ganz zusammengebrochen.«
»Was hat er denn getan?« Stedland wurde ungeduldig.
»Er hat sich an den Geldern der Bank vergriffen, mein Herr«, sagte Curtis heiser. »Wäre das vor zwei Jahren passiert, so wäre es nicht so schlimm gewesen, aber gerade jetzt, wo die Geschäfte so schlecht gehen und wir uns die größte Mühe geben müssen, unsere Bilanz in Ordnung zu bringen ich darf nicht daran denken, welche Folgen das noch haben wird.«
»Wieviel hat er denn genommen?« fragte Stedland schnell.
»Hundertfünfzigtausend Pfund!«
Stedland sprang erregt auf.
»Hundertfünfzigtausend Pfund?« rief er ungläubig.
»Jawohl, mein Herr. Ich kam zu Ihnen, um Sie zu bitten, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Sie sind doch einer der besten Kunden der Bank, und man hält viel auf Sie!«
»Was, ich soll auch noch ein gutes Wort für ihn einlegen!« schrie Stedland. Aber plötzlich wurde er wieder ruhig. Er erfaßte die Situation sofort und überdachte die Möglichkeiten. Schnell schaute er auf die Uhr – es war Viertel vor drei.
»Weiß in der Bank schon jemand etwas davon?«
»Nein, noch niemand, aber es ist meine Pflicht, dem Generaldirektor die ganze traurige Geschichte zu erzählen. Nach Geschäftsschluß werde ich ihn bitten, mir eine Privatunterredung zu gewähren und dann –«
»Gehen Sie jetzt zur Bank zurück?«
»Ja«, sagte Curtis überrascht.
»Nun hören Sie einmal zu, mein Freund.« Stedlands Gesichtszüge waren hart und undurchdringlich geworden. Er nahm zwei Banknoten aus seiner Brieftasche. »Hier haben Sie zwei Fünfzigpfundnoten – nehmen Sie die und gehen Sie nach Hause.«
»Aber ich muß wieder zur Bank zurück – man wird sich wundern –«
»Das ist ganz gleich, ob man sich wundert. Sie haben doch genügend Entschuldigungsgründe, wenn die ganze Sache herauskommt. Wollen Sie tun, was ich Ihnen sage und jetzt sofort nach Hause gehen?«
Der Mann nahm die beiden Banknoten zögernd.
»Ich weiß nicht, was Sie –«
»Das hat nichts zu sagen, was ich unternehmen werde. Ich habe Ihnen das Geld gegeben, damit Sie den Mund halten und nach Hause gehen. Können Sie denn nicht verstehen?«
»Ja – ich verstehe.« Curtis schwankte mit unsicheren Schritten aus dem Zimmer.
Fünf Minuten später öffneten sich die Glastüren der Molbury-Bank vor Mr. Stedland. Er ging sofort zur Kasse. Vornehme Ruhe herrschte in den Geschäftsräumen. Der Kassier, der ihn persönlich kannte, trat lächelnd zu ihm.
Stedland reichte ihm ein Blatt Papier. Der Mann sah es verwundert an und runzelte die Stirn.
»Das ist ja fast Ihr ganzes Guthaben bei uns, Mr. Stedland?«
»Ja, ich muß sehr eilig verreisen und komme vor zwei Jahren nicht zurück. Aber es bleibt doch noch genügend, um mein Konto aufrechtzuerhalten.«
Es war allgemein bekannt, daß die Firma Molbury & Co. bei solchen Gelegenheiten keine Schwierigkeiten machte.
»Dann wollen Sie wahrscheinlich auch den Inhalt Ihres Safes mitnehmen?« fragte der Kassier höflich.
»Ja, bitte.«
So erhielt er denn den Zinnkasten von der Bank zurück, den er dort deponiert und in den er von Zeit zu Zeit weitere Dokumente hineingelegt hatte.
Zehn Minuten später verließ er das Haus. Er hatte nahezu hunderttausend Pfund an Banknoten in seinen Taschen untergebracht und hielt einen Zinnkasten in der einen Hand. Mit der anderen beschützte er seine Hüftentasche, denn er war sehr vorsichtig. Dann bestieg er das wartende Taxi.
Als er in Clapham angekommen war, ging er direkt in sein Arbeitszimmer, schloß die Tür hinter sich zu und öffnete den kleinen Geldschrank, in den er zwei dicke Pakete von Banknoten und den Zinnkasten legte. Dann klingelte er nach Jope, und als er ihn kommen hörte, machte er ihm die Tür auf.
»Haben wir noch ein Feldbett hier im Hause?« fragte er.
»Jawohl, Mr. Stedland.«
»Dann bringe es hierher. Ich schlafe heute nacht in meinem Arbeitszimmer.«
»Ist etwas los?«
»Stelle keine dummen Fragen, sondern tu das, was ich dir sage!«
Morgen wollte er einen anderen sicheren Aufbewahrungsort für sein Vermögen suchen. Er brachte den Abend in seinem Arbeitszimmer zu und legte sich nieder, um zu ruhen, aber nicht, um zu schlafen. Auf dem Stuhl neben seinem Bett lag ein Revolver. Mr. Stedland war ein vorsichtiger Mann. Aber obwohl er sich fest vorgenommen hatte, kein Auge zuzutun, war er doch bereits eingeschlafen, als ihn Lärm von der Straße her plötzlich wieder weckte.
Von unten klangen die wohlbekannten Glockensignale der Feuerwehr herauf. Scheinbar war ein ganzer Zug unten in der Straße, denn er hörte Motorgeknatter und Stimmengewirr. Jetzt bemerkte er auch einen strengen Brandgeruch im Zimmer, und als er sich umsah, entdeckte er den Widerschein roten Feuers an der Decke. Sofort sprang er aus dem Bett – das halbfertige Gebäude nebenan stand in hellen Flammen. Die Leute waren schon an der Arbeit und bekämpften das Feuer mit mehreren Spritzen. Mr. Stedland lächelte vergnügt. Dieses Feuer würde ihm schöne Summen einbringen, denn er hatte das Bauwerk hoch versichert, und ihm selbst konnte ja nichts passieren.
Plötzlich hörte er unten im Flur lautes Sprechen. Eine tiefe Stimme gab irgendeinen Befehl, und Jope sprach aufgeregt dazwischen. Stedland schloß die Tür auf. In der Diele und auf der Treppe brannten die Lichter. Er schaute über das Geländer und sah Jope, der einen Mantel übergeworfen hatte und vor Kälte zitterte. Er stritt mit einem Feuerwehrmann, der einen großen Helm trug.
»Ich kann auch nichts dafür«, sagte der Mann. »Ich muß eine Schlauchleitung durch eins dieser Häuser legen. Ich kann keine Rücksicht darauf nehmen, daß dieses Haus Ihnen gehört.«
Mr. Stedland wünschte durchaus nicht, daß eine Schlauchleitung durch sein Haus gelegt wurde und hoffte, es so einrichten zu können, daß diese Unannehmlichkeit seinen Nachbarn aufgehalst wurde.
»Kommen Sie doch einen Augenblick herauf, ich möchte einen der Feuerwehrleute sprechen.«
Der Mann mit dem blitzenden Messinghelm stapfte die Treppe geräuschvoll nach oben.
»Tut mir selbst leid«, meinte er, »aber ich muß die Schlauchleitung –«
»Warten Sie einen Augenblick, mein Freund«, entgegnete Mr. Stedland lächelnd. »Ich glaube, wir werden uns gleich verständigt haben. Es gibt doch so viele Häuser in dieser Straße, und mit einer Zehnpfundnote kann man doch eine ganze Weile auskommen, nicht wahr? Treten Sie nur ruhig ein.«
Mr. Stedland ging in sein Zimmer zurück. Der Feuerwehrmann folgte ihm und beobachtete, wie er seinen Geldschrank aufschloß.
»Ich dachte nicht, daß es so leicht sein würde«, sagte er.
Stedland drehte sich erregt um.
»Hände hoch! Und machen Sie keine Schwierigkeiten, sonst ist es aus mit Ihnen, Noah! Ich bin durchaus bereit, Sie umzubringen!«
Noah Stedland sah, daß das Gesicht des Fremden unter dem großen Feuerwehrhelm von einer schwarzen Maske bedeckt war.
»Wer – wer sind Sie denn?« fragte er heiser.
»Ich bin einer der Vier Gerechten – die man so viel schmäht und die man vor der Zeit totgesagt hat. Und der Tod ist eins meiner Allheilmittel gegen alle Missetaten...«
*
Am nächsten Morgen um neun Uhr saß Mr. Noah Stedland noch in seinem Arbeitszimmer. Das Frühstück stand unberührt vor ihm auf dem Tisch.
Plötzlich kam Jope nach oben und brachte ihm eine böse Nachricht. Gleich hinter ihm trat Polizeiinspektor Holloway mit verschiedenen Polizeibeamten in den Raum.
»Wollen Sie nicht so gut sein und mich auf einen kleinen Spaziergang begleiten?« fragte der Beamte von Scotland Yard liebenswürdig.
Stedland erhob sich schwerfällig.
»Welche Klage erheben Sie gegen mich?« fragte er düster.
»Erpressung. Wir haben genug Beweismaterial, um sie an den Galgen zu bringen – wir haben es von einem besonderen Boten erhalten. Sie haben auch Storr ins Unglück gebracht das war besonders niederträchtig von Ihnen!«
»Wissen Sie eigentlich, wer Sie verpfiffen hat?« fragte der Oberinspektor, als Stedland seinen Mantel anzog.
Aber er erhielt keine Antwort. Manfreds letzte Worte, bevor er wieder auf der nebligen Straße verschwunden war, hatten tiefen Eindruck auf Stedland gemacht:
»Wenn wir Sie hätten umbringen wollen, dann hätte Sie der Mann, der sich Curtis nannte, am vorigen Nachmittag leicht töten können. Das wäre ebenso leicht gewesen, wie das Gebäude anzustecken. Und wenn Sie der Polizei irgend etwas von den Vier Gerechten verraten, dann werden wir sie umbringen, selbst wenn Sie hinter den dicksten Gefängnismauern von Petonville sitzen und ein Regiment Soldaten das Gebäude beschützt.«
2
Der Mann mit den grossen Eckzähnen
»Mord ist eigentlich das zufälligste Verbrechen, mein lieber George«, sagte Leon Gonsalez zu Manfred. Dabei nahm er seine große Hornbrille ab und schaute ihn sinnend an. Manfred, der Anführer der Vier Gerechten, liebte diesen Gesichtsausdruck seines Freundes und betrachtete ihn sehr vergnügt.
»Poiccart pflegte zu sagen, daß Mord eine sichtbare Äußerung von Hysterie sei«, erwiderte er lächelnd. »Aber warum sprichst du beim Frühstück über so gräßliche Dinge?«
Gonsalez setzte seine Brille wieder auf und wandte sich scheinbar aufs neue dem Studium seiner Zeitung zu. Er überhörte seinen Freund nicht absichtlich, sondern sein Geist war, wie George Manfred wohl wußte, so vollständig von seinen Gedanken beschäftigt, daß er die Frage überhaupt nicht vernommen hatte. Er blickte auch in die Zeitung, ohne zu lesen. Plötzlich begann er wieder zu sprechen.
»Achtzig Prozent aller Menschen, die unter Mordanklage stehen, kommen zum erstenmal mit dem Gericht in Berührung. Deshalb sage ich immer, daß Mörder eigentlich nicht zu den wirklichen Verbrechern gehören. Ich spreche natürlich von den Mördern der angelsächsischen Rasse. Es sind faszinierende Leute, George, wirklich faszinierend!«
Sein Gesicht leuchtete vor Begeisterung.
»Ich habe mich noch nicht zu dieser Anschauung durchringen können«, entgegnete Manfred. »Mir sind sie einfach schrecklich – für mich ist Mord immer noch die Verkörperung des größten Unrechts.«
»Vielleicht hast du recht«, antwortete Gonsalez zerstreut.
»Wie kamst du eigentlich auf diese merkwürdigen Gedanken«, fragte Manfred, als er seine Serviette zusammenrollte.
»Gestern abend habe ich einen Mann mit einer richtigen Mörderphysiognomie getroffen. Er bat mich um ein Streichholz und lachte, als ich es ihm gab. Ich konnte seine wunderbaren Zähnen sehen, sie waren vollkommen – nur...«
»Nun, was denn?«
»Nur die Eckzähne waren ungewöhnlich stark und lang. Außerdem hatte er tiefliegende Augen, erstaunlich gerade Brauen und unregelmäßige Gesichtszüge: Die letzte Eigenschaft deutet allerdings nicht unbedingt auf einen Verbrecher.«
»Das klingt ja, als wäre er ein richtiges Scheusal gewesen.«
»Im Gegenteil.« Gonsalez beeilte sich, den falschen Eindruck, den seine Worte hervorgerufen hatten, zu verbessern. »Er sah sehr gut aus. Nur jemand, der sich eingehend mit Physiognomien beschäftigt, konnte die Unregelmäßigkeit in seinen Gesichtszügen wahrnehmen. O nein, er konnte sich wirklich sehen lassen.«
Gonsalez erklärte noch näher, unter welchen Umständen er den Fremden getroffen und kennengelernt hatte. Er hatte am vorhergehenden Abend ein Konzert besucht, um die Wirkung der Musik auf bestimmte Typen von Menschen zu studieren. Sein ganzes Programm war mit Notizen vollgekritzelt, und er hatte nachher fast die halbe Nacht damit zugebracht, seine Beobachtungen auszuarbeiten.
»Er ist der Sohn von Professor Tableman. Mit seinem Vater steht er allerdings nicht sehr gut, weil dieser die Wahl seiner Verlobten nicht billigt. Außerdem haßt er seinen Vetter.«
Manfred lachte laut.
»Du bist wirklich großartig! Hat er dir das alles freiwillig erzählt, oder hast du ihn hypnotisiert und alle diese Nachrichten aus ihm herausgelockt? Übrigens hast du mich noch gar nicht gefragt, was ich gestern abend getan habe.«
Gonsalez steckte sich umständlich eine Zigarette an.
»Der junge Tableman ist fast zwei Meter groß, kräftig gebaut und hat solche Schultern!« Er hielt die Zigarette in der einen Hand, das brennende Streichholz in der anderen, um damit die ungewöhnliche Breite des jungen Mannes anzudeuten. »Er hat große, starke Hände, außerdem ist er ein bekannter Fußballspieler. Wo bist du nun gestern abend gewesen, George? Entschuldige, daß ich dich nicht eher danach gefragt habe.«
»In Scotland Yard«, entgegnete Manfred. Aber wenn er erwartet hatte, durch diese Mitteilung eine Sensation hervorzurufen, so mußte er enttäuscht sein. Aber offenbar kannte er Leon genügend, um daran überhaupt nicht zu denken.
»Scotland Yard ist ein ganz interessantes Gebäude«, meinte Gonsalez. »Der Architekt hätte nur die Westfassade nach Süden verlegen sollen – obwohl die versteckten Eingänge ganz mit dem Charakter des Baues übereinstimmen. Es fiel dir nicht schwer, dort Bekanntschaften anzuknüpfen?«
»Nicht im mindesten. Man kennt dort meine Arbeiten in Verbindung mit dem spanischen Strafgesetzbuch und mein Werk über Fingerabdrücke, und ich habe sofort Zutritt zum Polizeipräsidenten bekommen.«
Manfred war in London als der hervorragende Schriftsteller über Kriminologie, »Señor Fuentes«, bekannt. Er und sein Freund Leon Gonsalez hatten als spanische Wissenschaftler die besten Empfehlungsschreiben des spanischen Justizministers bei sich, die ihnen alle Türen öffneten. Manfred hatte lange Jahre in Spanien gelebt, und Gonsalez war dort geboren. Der starke freundliche Poiccart, der Dritte der berühmten Vier Gerechten, verließ selten seinen schönen Garten in Cordova. Vor zwanzig Jahren hatte auch noch der Vierte gelebt.
»Das mußt du unserem Freund Poiccart schreiben«, meinte Leon. »Er wird sich sehr dafür interessieren. Heute morgen habe ich einen Brief von ihm bekommen. Zwei seiner Mutterschweine haben Junge geworfen, und seine Orangenbäume stehen in Blüte.« Er lachte, wurde aber plötzlich wieder ernst. »Diese Polizeibeamten haben dich also an ihr Herz gedrückt?«
Manfred nickte.
»Sie waren sehr liebenswürdig und zuvorkommend. Wir werden morgen mit dem Polizeidirektor Mr. Reginald Fare zu Mittag speisen. Die Methoden der englischen Polizei sind seit unserem letzten Aufenthalt in London bedeutend besser geworden, Leon. Die Abteilung für Fingerabdrücke ist einfach musterhaft, und die neuen Leute, die man eingestellt hat, sind sehr intelligent und geschickt.«
»Sie werden uns noch hängen«, sagte Leon vergnügt.
»Ich glaube kaum!« erwiderte sein Freund.
Das Essen im Ritz-Carlton war recht gemütlich, und besonders Gonsalez fühlte sich sehr angeregt. Mr. Fare, ein Mann von mittleren Jahren, war nicht nur ein hervorragender Beamter und liebenswürdiger Gesellschafter, sondern auch ein befähigter Wissenschaftler auf seinem Spezialgebiet. Die Unterhaltung drehte sich bald lebhaft um die Ansichten und Beobachtungen von Marro, Lombroso, Fere, Mantegazza und Ellis.
»Für den gewohnheitsmäßigen Verbrecher besteht das Leben aus einer Reihe von Gefängnisstrafen, und wenn er gerade einmal nicht hinter Schloß und Riegel sitzt, denkt er an neue Taten und genießt das Leben, so gut er kann«, sagte Mr. Fare. »Dieser Ausspruch stammt nicht von mir, sondern ist schon über hundert Jahre alt. Mit den gewohnheitsmäßigen Verbrechern kommt man leicht aus. Aber wenn man mit Leuten zu tun hat, die nicht der Verbrecherklasse angehören, den Mördern, den zufälligen Gesetzesübertretern –«
»Das stimmt«, unterbrach ihn Gonsalez. »Ich behaupte immer –«
Er kam aber nicht dazu, seine Ansicht zu äußern, denn ein Page brachte Mr. Fare einen Brief. Der Polizeidirektor entschuldigte sich und überflog das Schreiben schnell.
»Hm – das ist ein sonderbares Zusammentreffen.« Er sah Manfred nachdenklich an. »Neulich sagten Sie, daß Sie die Beamten von Scotland Yard gerne aus der Nähe bei der Arbeit beobachten möchten, und ich versprach, Ihnen eine Gelegenheit dazu zu geben – sie ist schon da!«
Mr. Fare winkte den Kellner heran und zahlte seine Rechnung.
»Ich werde mir wahrscheinlich auch Ihre reiche Erfahrung zunutze machen«, fuhr er dann fort, »denn es ist möglich, daß wir bei diesem Fall alle Hilfe in Anspruch nehmen müssen, die wir nur irgendwie erreichen können.«
»Worum handelt es sich denn?« fragte Manfred, als sie in dem Auto Mr. Fares saßen, das sich mühsam durch den lebhaften Verkehr bei Hyde Park Corner durcharbeitete.
»Man hat einen Mann unter außergewöhnlichen Umständen tot aufgefunden. Er nahm eine hervorragende Stellung in der wissenschaftlichen Welt ein – vielleicht ist Ihnen der Name auch bekannt – ein gewisser Professor Tableman.«
»Tableman?« fragte Gonsalez erstaunt. »Das ist doch zu merkwürdig! Sie sprachen vorhin von einem sonderbaren Zusammentreffen. Nun will ich Ihnen einen anderen Fall erzählen.«
Er berichtete von seiner Begegnung mit dem Sohn des Professors.
»Persönlich«, fuhr Gonsalez fort, »betrachte ich solche Duplizitäten als etwas Normales. Wenn ich morgens eine Rechnung erhalte, so bin ich sicher, daß ich an demselben Tag noch eine oder mehrere zugesandt bekomme. Und wenn mir ein Scheck mit der ersten Post zugestellt wird, so weiß ich gewiß, daß mit der zweiten oder dritten noch einer einläuft. Eines Tages werde ich diesen Zusammenhängen noch einmal genauer nachforschen.«
»Professor Tableman wohnt in Chelsea«, erklärte Mr. Fare. »Vor einigen Jahren kaufte er sein jetziges Haus von einem Künstler und ließ das geräumige Atelier in ein Laboratorium umwandeln. Er las an der Bloomsbury-Universität über Physik und Chemie und besaß ein beträchtliches Vermögen. Ich kannte ihn persönlich und speiste noch ungefähr vor einem Monat mit ihm zu Abend. Er hatte damals eine Auseinandersetzung mit seinem Sohn. Der Professor war ein eigenwilliger, unbeugsamer Mann, einer dieser alten Leute, die sich ein Vorbild an den Patriarchen des Alten Testaments nehmen und die milden Lehren des Neuen Testaments nicht kennen.«
Inzwischen waren sie vor Tablemans hübschem, modernem Haus angekommen. Es lag in einer der Straßen, die von King's Road abzweigen. Offenbar war die Nachricht von dem traurigen Ereignis bis jetzt nicht bekanntgeworden, denn die übliche Menge neugieriger Zuschauer hatte sich noch nicht eingefunden. Ein Detektiv erwartete sie und führte Mr. Fare durch einen gedeckten Gang, der an der Seite des Hauses entlanglief. Dann stiegen sie eine Reihe von Stufen empor, die direkt zu dem Laboratorium führten. Der große Raum zeigte kein ungewöhnliches Aussehen, nur war er sehr gut erleuchtet, da eine der Wände aus einem großen Fenster bestand und die Decke des Raumes von einem abfallenden Glasdach gebildet wurde. Breite Arbeitstische standen an den beiden Längsseiten; ein großer Tisch in der Mitte war mit wissenschaftlichen Apparaten bedeckt, während zwei lange Regale über den Tischen mit Flaschen und Gefäßen gefüllt waren, die wahrscheinlich Chemikalien enthielten.
Ein hübscher junger Mann erhob sich von einem Stuhl, als sie eintraten.
»Ich bin John Munsey«, sagte er, »der Neffe des Professors. Vielleicht entsinnen Sie sich an meinen Namen, Mr. Fare? Ich assistierte meinem Onkel bei seinen Experimenten.«
Fare nickte. Er betrachtete die Gestalt, die zwischen den Bänken und dem großen Tisch auf dem Boden lag.
»Ich habe ihn nicht angerührt«, sagte der junge Mann mit leiser Stimme. »Ich habe alles so gelassen, wie es war. Nur die Detektive, die hierherkamen, haben seine Lage etwas verändert, um dem Arzt bei der Untersuchung zu helfen.«
Professor Tableman war von großer, hagerer Gestalt. In seinen Gesichtszügen prägten sich unverkennbar Schrecken und Todesangst aus.
»Es sieht so aus, als ob er erwürgt worden wäre«, meinte Fare. »Hat man einen Strick oder eine Schnur gefunden?«
»Nein. Auch die Detektive äußerten die Ansicht, und wir haben daraufhin das ganze Laboratorium eingehend untersucht, aber nichts Derartiges gefunden.«
Gonsalez kniete bei dem Toten nieder und schaute interessiert auf den nackten Hals. Um die Kehle lief ein blauer Streifen, der tief eingeschnitten war. Zuerst hielt er ihn für ein Band aus durchsichtigem Stoff, aber bei näherer Betrachtung erkannte er deutlich, daß nur die Haut so verfärbt war. Dann schaute er auf den Tisch, neben dem der Professor niedergefallen war.
»Was ist denn das?« fragte er und zeigte auf eine kleine grüne Flasche, neben der ein leeres Glas stand.
»Das ist eine Flasche Likör«, erwiderte Mr. Munsey. »Mein armer Onkel trank gewöhnlich ein Gläschen, bevor er sich schlafen legte.«
»Gestatten Sie?« fragte Leon, und Fare nickte.
Gonsalez nahm das Glas auf und roch daran, dann hielt er es gegen das Licht.
»Das Glas wurde gestern abend nicht mit Likör gefüllt. Er muß also getötet worden sein, bevor er trinken konnte«, sagte Mr. Fare. »Mr. Munsey, würden Sie mir einmal die ganze Geschichte erzählen, soweit Sie sie wissen? Schlafen Sie eigentlich hier im Hause?«
Nachdem Mr. Fare den Detektiven einige Aufträge gegeben hatte, folgte er dem jungen Mann in die Bibliothek des verstorbenen Professors.
»Ich war der Assistent meines Onkels und seit drei Jahren sein Sekretär«, begann Mr. Munsey. »Das Verhältnis zwischen uns ist immer herzlich gewesen. Mein Onkel brachte den Morgen gewöhnlich in der Bibliothek zu, am Nachmittag arbeitete er entweder im Laboratorium oder in seinen Arbeitsräumen auf der Universität. Nach dem Abendessen beschäftigte er sich dann mit seinen Experimenten im Laboratorium, bis er sich schlafen legte.«
»Speiste er gewöhnlich zu Hause?« fragte Mr. Fare.
»Ja. Nur wenn er abends noch eine Vorlesung hatte oder in einer wissenschaftlichen Gesellschaft einen Vortrag hielt, speiste er im Royal Society's Club in der St. James' Street.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, hatte sich mein Onkel mit seinem Sohn Stephen überworfen. Der junge Tableman ist ein guter Freund von mir, und ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, um die beiden wieder miteinander auszusöhnen. Ungefähr vor zwölf Monaten schickte mein Onkel nach mir und sagte mir hier in der Bibliothek, daß er sein Testament geändert und sein ganzes Vermögen mir vermacht hätte. Sein Sohn wäre vollständig enterbt. Ich war sehr beunruhigt, ging sofort zu Stephen und bat ihn, keine Zeit zu versäumen und sieh mit seinem Vater wieder zu vertragen. Aber Stephen lachte nur und sagte, daß ihm nichts an dem Geld seines Vaters läge und daß er lieber auf sein Erbe verzichten wolle, bevor er Miss Faber aufgäbe. Der ganze Streit mit seinem Vater drehte sich nämlich um seine Verlobung. Er wollte lieber mit dem kleinen Einkommen vorliebnehmen, das ihm aus dem Erbteil seiner Mutter zufloß. Als ich bei meinem Vetter nichts ausrichten konnte, ging ich zu dem Professor zurück und bat ihn, seinen Sohn wieder als Erben in sein Testament einzusetzen. Ich gebe zu«, fuhr er lächelnd fort, »daß ich wohl ein kleines Legat erwarten durfte. Ich habe dasselbe Spezialgebiet als Wissenschaftler wie mein Onkel, und ich habe den Ehrgeiz, seine Lebensarbeit fortzusetzen. Aber der Professor wollte nichts von meinem Vorschlag hören. Er war sehr ungehalten und ärgerlich, und ich hielt es für besser, nicht weiter über die Angelegenheit zu sprechen. Trotzdem legte ich mit der Zeit immer wieder ein gutes Wort für Stephen ein, und als der Professor letzte Woche in einer ungewöhnlich günstigen Stimmung war, habe ich die ganze Sache wieder vorgebracht, und er stimmte auch zu, daß er seinen Sohn wieder sehen wolle. Sie trafen sich hier im Laboratorium. Ich war bei der Unterredung nicht zugegen, aber ich nehme an, daß es einen schrecklichen Streit gegeben hat. Als ich hereinkam, war Stephen schon fort. Mr. Tableman war außer sich vor Zorn. Offensichtlich hat er darauf bestanden, daß Stephen seine Verlobung lösen solle, was dieser schroff ablehnte.«
»Auf welchem Weg kam Stephen denn in das Laboratorium?« fragte Gonsalez. »Gestatten Sie, daß ich diese Frage stelle, Mr. Fare?« Der Polizeidirektor nickte.
»Er kam durch den seitlichen Gang. Nur wenig Leute betreten das Haus, außer solchen, die in rein wissenschaftlichen Angelegenheiten kommen.«
»Dann kann man also zu jeder Zeit ins Laboratorium gelangen?«
»Ja, bis abends das äußere Gartentor abgeschlossen wird«, erwiderte der junge Mann. »Mein Onkel pflegte jeden Abend noch einen kleinen Spaziergang zu machen, bevor er zu Bett ging, und benutzte gewöhnlich diesen Ausgang.«
»War das Gartentor gestern abend geschlossen?«
»Nein. Das war eins der ersten Dinge, die ich nachprüfte. Das Tor nach draußen war nicht zugeschlossen und stand nur angelehnt. Es ist ja eigentlich kein festes Tor, sondern nur ein Eisengitter, wie Sie wohl bemerkt haben.«
»Fahren Sie nur fort«, sagte Mr. Fare und nickte.
»Der Professor beruhigte sich allmählich wieder. Ein paar Tage lang war er sehr still und nachdenklich. Ich glaube, sein Verhalten tat ihm leid. Am Montag – was haben wir heute? Donnerstag – ja, es war Montag, sagte er zu mir: ›John, wir wollen noch einmal über Stephen sprechen. Glaubst du, daß ich ihm Unrecht getan habe?‹ – ›Du warst sehr hart gegen ihn, Onkel‹, erwiderte ich. ›Ja, vielleicht war ich zu schroff. Miss Faber muß doch ein sehr anziehendes Mädchen sein, wenn Stephen ihretwegen auf sein Erbe verzichten will.‹ Auf diese Gelegenheit hatte ich gewartet, und ich versuchte nun mit allen Mitteln, meinen Onkel wieder für Stephen günstig zu stimmen. Schließlich gab der alte Mann nach und sandte Stephen ein Telegramm, in dem er ihn bat, gestern abend noch einmal hierherzukommen. Der Professor muß schwer mit sich gekämpft haben, um seinen Widerstand gegen Miss Faber aufzugeben, denn wenn es sich um erbliche Belastung handelte, war er sonst ganz fanatisch und unbeugsam –«
»Was meinen Sie mit erblicher Belastung?« unterbrach ihn Manfred schnell. »Was stimmte denn bei Miss Faber nicht?«
»Ich weiß es nicht.« Mr. Munsey zuckte die Achseln. »Aber der Professor hatte gehört, daß ihr Vater in einem Trinkerheim gestorben sein soll. Meiner Meinung nach war das Gerücht vollständig haltlos.«
»Was geschah denn nun gestern abend?« fragte Mr. Fare.
»Soviel ich weiß, kam Stephen zu der Unterredung. Ich hielt mich wohlweislich fern und schrieb in meinem eigenen Zimmer einige Briefe, die schon lange fällig waren. Ungefähr um halb zwölf kam ich herunter, aber der Professor war noch nicht in die Wohnung zurückgekommen. Von hier aus können Sie die Fenster des Laboratoriums sehen, und als ich bemerkte, daß drüben noch Licht brannte, dachte ich, die Unterredung hätte sich in die Länge gezogen. Ich hoffte, daß sich die beiden versöhnen würden, wollte nicht weiter stören und ging zu Bett. Es war früher, als ich mich gewöhnlich hinlege, aber es war nichts Besonderes daran, daß ich dem Professor nicht gute Nacht sagte.
Und heute morgen wurde ich um acht Uhr vom Hausmeister geweckt. Er sagte mir, daß der Professor nicht in seinem Zimmer sei. Auch das war nicht merkwürdig. Manchmal, wenn er spät im Laboratorium gearbeitet hatte, setzte er sich nur in seinen Armsessel und schlief dort, ohne sich auszukleiden. Ich habe ihm darüber Vorhaltungen gemacht, so oft ich nur konnte, aber er ließ sich in dieser Beziehung nichts sagen. Ich zog meinen Bademantel an und ging ins Laboratorium hinunter, das man auf dem Weg erreichen kann, den wir eben gegangen sind. Als ich eintrat, sah ich ihn auf dem Boden liegen und fand zu meinem Entsetzen, daß er tot war.«
»Stand die Tür zum Laboratorium offen?« fragte Gonsalez.
»Sie war angelehnt.«
»Und die Gartentür war auch angelehnt?«
Munsey nickte.
»Haben Sie nichts von einem Streit gehört?«
»Nichts.«
Es wurde draußen geklopft. Munsey ging zur Tür und öffnete.
»Es ist Stephen«, sagte er.
Gleich darauf trat der junge Mr. Tableman ein. Hinter ihm erschienen zwei Detektive. Sein Gesicht war blaß, und als er seinen Vetter mit einem schwachen Lächeln begrüßte, sah Manfred die außerordentlich starken Eckzähne. Die anderen Zähne waren von normaler Größe.
Stephen Tableman war von riesiger Körpergröße, und als Manfred seine großen Hände bemerkte, biß er sich nachdenklich auf die Lippen.
»Sie haben die traurige Nachricht erhalten, Mr. Tableman?«
»Ja«, sagte Stephen mit leise zitternder Stimme. »Kann ich meinen Vater sehen?«
»Gleich«, entgegnete Mr. Fare scharf. »Sie müssen mir erst ein paar Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Vater zuletzt gesehen?«
»Ich habe ihn noch gestern abend lebend getroffen«, erwiderte Stephen schnell. »Er hatte mich in das Laboratorium bestellt, und wir hatten eine lange Aussprache miteinander.«
»Wie lange waren Sie hier?«
»Ungefähr zwei Stunden, soweit ich mich besinnen kann.«
»Verlief die Unterredung friedlich und freundlich?«
»O ja, mein Vater war sehr lieb zu mir«, sagte Stephen mit besonderem Nachdruck. »Seit über einem Jahr« – er zögerte einen Augenblick –, »haben wir uns zum erstenmal ruhig über eine gewisse Angelegenheit unterhalten können.«
»Sie sprachen mit Ihrem Vater über Ihre Verlobte, Miss Faber?«
Stephen sah ihn ruhig an.
»Ja, wir sprachen über sie.«
»Haben Sie auch noch über anderes mit Ihrem Vater gesprochen?«
Stephen zögerte abermals.
»Wir haben auch über Geld gesprochen«, sagte er dann. »Mein Vater hatte die Summe, mit der er mich unterstützte, nicht weiter ausgezahlt, und ich war infolgedessen in einiger Verlegenheit. Ich hatte mein Konto bei der Bank überzogen, und er versprach mir, die Sache in Ordnung zu bringen. Auch haben wir uns über – die Zukunft unterhalten.«
»Kam dabei auch das Testament zur Sprache?«
»Ja, mein Vater sagte, daß er seinen Letzten Willen ändern wolle.« Bei diesen Worten sah er lächelnd zu Munsey hinüber. »Mein Vetter hat mich stets verteidigt und alles getan, was er für mich tun konnte. Ich kann ihm nicht dankbar genug sein, daß er in diesen traurigen Zeiten treu zu mir gehalten hat.«
»Haben Sie das Laboratorium durch den Seitenausgang verlassen?«
Stephen nickte.
»Und haben Sie die Tür geschlossen?«
»Mein Vater hat zugeschlossen. Ich kann mich deutlich darauf besinnen, daß ich das Schloß einschnappen hörte, als ich den Gartenweg entlangging.«
»Kann die Tür von außen geöffnet werden?«
»Ja. Es ist ein Schloß daran. Aber der einzige Schlüssel ist im Besitz meines Vaters. Das stimmt doch, John?«
Mr. Munsey nickte.
»Wenn Professor Tableman also die Tür schloß, konnte sie nur von jemand geöffnet werden, der selbst in dem Laboratorium war?«
Stephen schaute erstaunt auf.
»Ich verstehe die Bedeutung dieser Frage nicht ganz. Der Detektiv sagte mir, daß mein Vater tot aufgefunden wurde. Was war denn die Todesursache?«
»Ich nehme an, daß er erdrosselt wurde«, erklärte Mr. Fare ruhig.
Stephen trat entsetzt einen Schritt zurück.
»Erdrosselt?« wiederholte er leise. »Aber er hatte doch keinen Feind auf der ganzen Welt.«
»Das wird die Untersuchung ergeben«, sagte Fare trocken. »Sie können jetzt gehen, Mr. Tableman.«
Nach einem kleinen Zögern entfernte sich Stephen und ging in das Laboratorium. Nach einer Viertelstunde kam er totenbleich zurück.
»Es ist zu schrecklich! Mein armer Vater!«
»Soviel ich weiß, haben Sie Medizin studiert, Mr. Tableman? Ich glaube, Sie sind Assistenzarzt am Middlesex-Hospital«, sagte Mr. Fare. »Sind Sie auch der Meinung, daß Ihr Vater erdrosselt wurde?«
Stephen nickte.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.
This is a free sample. Please purchase full version of the book to continue.